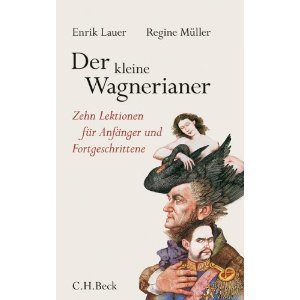Ich lebte nach dem Zweiten Weltkrieg mit meinen Großeltern und meiner Mutter (mein Vater kehrte erst 1954 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück) in zwei großen, miteinander verbundenen Wohnungen in Halle an der Saale. Ich hörte bei meiner Mutter den Larifari-Rundfunk, der sich heute so gigantisch leer aufplustert. Aber bei meinen Großeltern durfte ich an alles ran, an die Doré-Bibel, Raffael-, Michelangelo- und Altdorfer-Mappen – und ans Grammophon mit den 78er Platten, Michael Haydns ‚Kindersinfonie’, Mozarts Kleine Nachtmusik, Choräle von Bach, Johann Strauß’ Walzer An der schönen blauen Donau – da war ich 6 Jahre alt. Das war die erste Begegnung mit MUSIK. Meine Mutter sang aber sehr schön Schlager der Zeit, „Regentropfen, die an mein Fenster klopfen“, mit meiner Frankfurterisch sprechenden Großmutter sang ich Rheinlieder…
Als ich mit 7 meine Greifswalder Tante mit meinen Großeltern besuchte, durchstöberte ich die Schallplattenständer, mein Onkel hatte ein elektrisch betriebenes Grammophon, ich hörte Schuberts „Unvollendete“ – auf 4 Platten.
Mein erster Opernbesuch war im Jahr 1954: „Zar und Zimmermann“ von Lortzing. Es ist ein Jammer, dass diese wunderbare Oper heute fast nicht mehr gespielt wird. Ein Jahr später Mozarts „Zauberflöte“, die erste Arie der Königin der Nacht sang ich ohne Text nach, das weiß ich noch. In dieser Zeit hörte ich auch Humperdincks grandiose Oper „Hänsel und Gretel“, die leider nicht für Erwachsene inszeniert wird, sondern immer nur in der Weihnachtszeit für Kinder.
Unvergesslich: Beethovens Fünfte, die ich im Treppenhaus der Villa Westfalia mit allen Bewohnern des Hauses 1956 hörte. Gerd Pörschmann, ein Untermieter, legte die Platte auf, riss seine Tür auf und rief das ganze Haus herbei, meine Großeltern, die Gräfin (unsere Vermieterin) und ihre erwachsenen Töchter, meinen Vater, der unter dem Dach wohnte und Medizin studierte. Ich kam auch gelaufen, sah Pörschmann dirigieren und hörte zu. „Die Schicksalssinfonie!“, rief Pörschmann, „es gibt nichts Größeres!“ Die Töne schallten aus dem kleinen Lautsprecher im Plattenspieler durch das ganze Haus. Und als der erste Satz endete, fielen wir uns alle in die Arme.
Mein schwerhöriger Großvater sang, wenn er sich allein glaubte, Motive aus Wagners Opern, er brummte sie vor sich hin, variierte sie und extemporierte ähnliche Melodien und Rhythmen. Auf der Toilette, wo er viel Zeit verbrachte, summte er stets die gleiche Melodie. Ich konnte sie noch viele Jahre nach seinem Tod still im Kopf singen. Es war eine Variante des Walkürenritts, den ich kennenlernte, als ich die Oper Jahre später im Radio hörte. Natürlich weiß ich nicht sicher, ob die anderen Brummeleien Wagneriaden waren. Doch er sprach immer wieder von Wagner, von Lohengrin und dem Fliegenden Holländer, von Siegfried und Parsifal, und brachte den Charakter der ewigen Melodie und der motivischen Verflechtung zum Ausdruck. – Manchmal, wenn Papa Carlo, der unter starken Melancholien litt, guter Dinge war, sang er mit mir zusammen „Die musikalische Familie“, er ahmte dann die Instrumente nach, doch geriet das mit seinem tiefen Bass und meiner hellen Jungenstimme so komisch, dass wir uns schief lachten und über die erste Strophe nie hinauskamen:
Es war bei uns im Elternhause ein jeder ein Musikgenie,
wir spielten täglich ohne Pause in wunderbarer Harmonie.
Das Abendbrot war kaum genossen, die Noten wurden schnell gebracht,
so ging es frisch und unverdrossen gewöhnlich bis um Mitternacht.
Mama, die spielte Flöte, Fagott der Herr Papa,
die Tante blies Trompete, Posaune Großmama,
und meine Schwester Jette, die spielte Klarinette,
ich selber strich zum Spaß den großen Kontrabass.
Erst spielten wir ganz leise piano pianissimo…
Dann machte unsere Herzen froh ein schluchzendes Adagio.
Bis von Begeisterung gepackt wir spielten im Dreivierteltakt.
Und dann gings los in jubilo fortissimo fortissimo! …
Und der Großvater sang Loewe-Balladen – Archibald Douglas: Ich hab es getragen sieben Jahr, und ich kann es nicht tragen mehr, wo immer die Welt am schönsten war, da war sie öd und leer!, Erlkönig: Wer reitet so spät durch Nacht und Wind…, Prinz Eugen der edle Ritter, Tom der Reimer, und besonders gern sang er Die Uhr:
Ich trage, wo ich gehe,
Stets eine Uhr bei mir;
Wieviel es geschlagen habe,
Genau seh ich an ihr.
Als ich acht Jahre alt wurde, schenkten mir die Großeltern eine Uhr, und mein Großvater schrieb dazu ein Gedicht, das er mit den Versen des Liedes begann. Dann folgten die Verse an mich:
Dies sehr bekannte Loewe-Lied,
Dem Deine Sehnsucht gilt,
Wir haben’s auf dem Grammophon
So manches Mal gespielt. …
Gewöhne dich an Pünktlichkeit.
Das kann die Uhr Dir geben.
Sei für die Mutti stets bereit.
Dann kommst Du weit im Leben.
Unter Harmoniumklängen mit der Melodie dieses Liedes wurde mein Großvater 1956 im Krematorium des Bonner Zentralfriedhofs verbrannt. Da war ich 11 Jahre alt. Ein halbes Jahrhundert später wurde mein Vater aufgebahrt, und der Organist spielte das Lied von der Uhr, diesmal im Krematorium des Waldfriedhofs von Birkenfeld über der Enz.
Pop-Musik gab es in den 50er Jahren noch gar nicht. Als ich 1955, zehn Jahre alt, in den Westen kam, war Elvis Presley groß da. Aber seine Songs lagen mir nicht, und schon gar nicht seine dummen Filme. Besser klang, zumal ich kein bisschen Englisch konnte, „Pack die Badehose ein“. Mein Vater hörte, als ich in meine pubertären Jahre kam, preußische Marschmusik und Operetten.
Ich sehe mich, wie ich unter dem Radio, das auf vier Beinen stand, lag und Verdis „Troubadour“ wie im Rausch hörte. Vielleicht war ich da 14. Im Schulfunk des WDR kam nachmittags eine interessante Analyse: „Der Freischütz“. In der Arie „Ist kein Gott?“ fällt der höchste Ton der Tenorlage auf „Gott“. – Und so ging es weiter. Beethovens 5. Klavierkonzert, Mozarts „Entführung aus dem Serail“, Liszts 2. Ungarische Rhapsodie, Dvoraks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“, massenhaft Opernarien auf 45er LPs, die ich bei meiner Tante in Bonn hörte, gesungen von Erna Berger, Maria Cebotari, Benjamin Gigli, Richard Tauber…
In meiner Klasse gab es drei oder vier Gleichgesinnte, der Musikunterricht war vollkommen auf Klassik abgestellt. Am Gymnasium in Neuenbürg an der Enz sprachen wir im Lateinunterricht über Metren und Musik. Ich erinnere mich, wie ich die Struktur aller vier Sätze des 2. Klavierkonzerts von Brahms an die Tafel zeichnete. Bei einem Treffen meiner Klasse bei unserem Klassenlehrer, der uns in Latein, Geschichte und Deutsch unterrichtete – wir waren in der Unterprima nur noch ungefähr 20 Schüler –, dirigierte ich Beethovens Violinkonzert, das vom Plattenspieler erklang, für ein imaginäres Orchester. Walter Ptok, ein Mitschüler, brachte eines Tages die Platte „Lyrik und Jazz“ mit, Gert Westphal sprach Gedichte von Benn über der Musik von Dave Brubeck. Im Unterricht stritten wir darüber, ob Bachs Inventionen mit Klavier oder Cembalo, mit oder ohne Pedal zu spielen seien. Wir diskutierten über Sinn und Unsinn von Jacques Loussier’s „Play Bach“ und die „Swingle Singers“, die wir gegen unsere Eltern verteidigten. Gerhard Huber spielte ein Prélude von Rachmaninow, mit Bleifuß auf dem Pedal, Walter Ptok rief: Nicht so sentimental, das musst du härter spielen, genauer! Der Musiklehrer Armbruster, der mit dem großen Schulchor und zwei Klavieren in der alten Turnhalle Orffs „Carmina Burana“ aufführte, ließ uns gewähren. Jede Stunde sprachen wir über andere Komponisten. Wir verstanden nicht, warum Armbruster Händel als Lieblingskomponisten verehrte, Händel war für uns Weihnachten, wir kannten nicht eine seiner Opern, noch nicht einmal die Concerti grossi. Bach musste es sein, Mozart und Beethoven! Einmal brachte Ptok wieder den tragbaren Schallplattenspieler und das 5. Brandenburgische Konzert mit und legte es nach der 6. Stunde für den kleinen Club der Kulturisten auf, das waren Huber, Rexer, Klemke, Jung und ich. Die Kadenz im ersten Satz wollte nicht enden, aber es war kein Sprung in der Platte. Ptok: „Das ist immer noch Weltrekord! Das hat kein Komponist mehr überboten! Vielleicht irgendein Pianist, aber niemals so fließend wie Bach.“ Wir hörten enthusiastisch unsere Musik von selbst gekauften Schallplatten, in der tiefen Provinz gab es kaum Konzerte. In dem kleinen Schwarzwaldstädtchen wurde ab und zu Kammermusik im Gemeindehaus gespielt, meist Barock, Telemann, aber da gingen wir nicht hin. In Pforzheim gab es ein Kammerorchester. Ein Konzert mit Hindemith schreckte uns ab, so weit waren wir noch nicht. Oder Violinsonaten von Bela Bartok. Zu früh für uns. Wir diskutierten lieber über die Frage, ob Nikolaus Harnoncourt oder Karl Richter der bessere Bach-Interpret war.
Ich war süchtig nach weiteren Werken der E-Musik. Eines Tages lud mich Werner Polster, ein Mitschüler aus dem Club der Kulturisten, zu sich nach Hause ein. Unter den Schallplatten im Wohnzimmer entdeckte ich Dvoraks Cellokonzert h-moll, das ich noch nicht kannte. Die Eltern sagten: „Wir legen die Platte auf, hör sie dir mal an.“ Werner machte sich inzwischen für das Fußballspiel fertig. Und ich hörte Dvorak im Wohnzimmer seiner Eltern… Die Musik nahm mich in Besitz. Als Werner im Trikot in der Tür stand und fragte: „Kommst du mit?“, entschied ich mich für Dvorak. Da verlor ich jemanden, der mein Freund werden wollte, und ich merkte es nicht im Rausch der Musik.
Pop und Rock lernte ich erst spät kennen – die Songs der Beatles beeindruckten mich, besonders „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“. Kurz darauf die Rolling Stones mit der LP „Their Satanic Majestie’s Request“. Das war nach dem zweijährigen Bundeswehrdienst. Ich war 21. Aber diese Musik ging nicht tief in meine Seele rein.
In der Militärzeit schwenkte ich vom konservativen bürgerlichen Weltbild meines Elternhauses um zur sozialdemokratischen Linie Willy Brandts und hörte mit Kameraden auf der Stube Franz-Josef Degenhardts Lieder, „Ich möchte Weintrinker sein“ und „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“, allerdings noch stark hedonistisch motiviert. Französische Chansons hallten abends in den Fluren der Kaserne, am liebsten hörten wir Georges Brassens, Chanson pour l’Auvergnat, Les Sabots de pauvre Hélène, Les Philistins… Wenn ich allein das Wochenende in der Leipheimer Kaserne verbrachte, las ich Thomas Manns Erzählungen und das Neue Testament und hörte die LPs, die ich mir in Ulm kaufte, eine Platte der Deutschen Grammophon kostete 25 Mark. In der Stille des Sonntags fand ich zu Bruckner (Romantische Sinfonie) und Strawinsky (Le Sacre du Printemps).
Im Februar 1967 war ich in Berlin und nahm an einer Fernsehsendung („Jugend diskutiert“) mit Matthias Walden als Moderator teil. Ich forderte in der Diskussion die Anerkennung der DDR. Danach traf ich mich in Ost-Berlin mit meiner Mutter, die in Halle lebte, im Café Moskwa, wo wir auf Karl-Friedrich Kaul trafen, der uns in seinem Mustang zu einem Fotografen brachte. Im Auto sagte meine Mutter: „Das ist mein Sohn aus dem Westen.“ Kaul: „Na, junger Mann, wie gefällt es Ihnen in der Deutschen Demokratischen Republik?“ Ich: „Die DDR ist ein Unrechtsstaat, eine Diktatur mit Pseudosozialismus.“ Meiner Mutter stockte der Atem. Kaul war politischer Rechtsanwalt und wirkte zuweilen bei Sudel-Edes Schwarzem Kanal mit. „Aha“, sagte Kaul, „da sind Sie bei dem Nazischwein Kiesinger in der Tat besser aufgehoben.“ Als Kaul uns vor dem Fotoladen abgesetzt hatte, war das Treffen mit meiner Mutter beendet. Sie warf mir vor, sie in eine unkalkulierbare Situation gebracht zu haben, ich blieb bei meiner Meinung. Unsere Wege trennten sich. Ich ging ins „Haus der deutsch-tschechoslowakischen Freundschaft“ und kaufte mir etliche Supraphon-Schallplatten mit russischen Komponisten der Gegenwart: Prokofiews 3. Klavierkonzert, Katschaturians Violinkonzert, ein Klavierkonzert von Kabalewski. Und Werke von Honegger, Janacek, Kammermusik von Hindemith, Roussel, Milhaud, Poulenc… Ich musste als Angestellter im Bonner Verteidigungsministerium meinen Abstecher nach Ost-Berlin bei meinem Dienstherrn melden. Zwei Mal besuchten mich Mitarbeiter des Militärischen Abschirm-Dienstes (MAD) oder des Bundesnachrichtendienstes (BND) oder des Verfassungsschutzes und verlangten Auskunft über jeden Schritt von mir, auch eine vollständige Liste der von mir gekauften Schallplatten.
Als ich nach der Militärzeit vor dem Abendabitur stand, legte ich zum Lernen Richard Strauss’ Tondichtung Also sprach Zarathustra, Wagners Ouvertüren und den Fliegenden Holländer bis in die späte Nacht auf. Das war der Baronin, meiner Vermieterin, obwohl sie schwerhörig war, zu laut, ich musste den Apparat leiser drehen. Die Musik, die ich hörte, drang so tief in mein Unterbewusstsein ein, dass ich eines Nachts eine neue Wagner-Musik träumte, das Orchester dröhnte und kreiste in meinem Kopf, ich wachte auf und drehte die Musik ab, die ich komponieren musste, ohne sie je richtig gehört zu haben. Es muss damit zusammenhängen, dass ich in diesen Tagen Kleists Erzählung „Cäcilie oder die Gewalt der Musik“ las, mit der sich mein Traum geheimnisvoll berührte.
In dieser Zeit hörte ich Stockhausens „Gesang der Jünglinge im Feuerofen“, ein geniales, aber mühsames Tonbandgeschnipsel, als Vorstufe der elektronischen Musik, die ihren Weltmittelpunkt in Köln beim WDR hatte. Spiral, das Klavierstück XI und Zyklus für einen Schlagzeuger waren kammermusikalische Werke Stockhausens, die ich, wie Schönbergs Violinkonzert, auflegte, wenn mir die romantische Musik zuviel wurde. Mauricio Kagels unernste Musik war mir dagegen zu beliebig.
Anfang der 80er Jahre entdeckte ich die „Einstürzenden Neubauten“ mit FM Einheit, die Heiner Müllers „Hamletmaschine“ zu einer Art Musikhörspiel machten, mit dem Autor als Sprecher, dessen rauchige Stimme das eigene Selbstbewusstsein vertonte. FM Einheit schrieb Ende des Jahrtausends die Oper „Alzheimer 2000. Toter Trakt“, die mit dem bombastischen Stahlröhrenschlagzeug die terroristische Atmosphäre auf die Bonner Opernbühne hochmischte. Oder Jethro Tull, Leonard Cohen, Bobby McFerrin. Die ‚Klassik’, zunehmend Kammermusik und moderne, zeitgenössische Musik blieb ganz oben.
Strawinsky lebte noch…! Und Picasso…
Ich hörte Elly Ney in Bonn die drei letzten Sonaten Beethovens spielen, in der subjektivistischen Musikauffassung des Fin de Siècle. Als sie „Guten Abend, gute Nacht“ von Brahms als Zugabe spielte, lag die Beethovenhalle der Ehrenbürgerin zu Füßen, viele weinten. Es war wie im Woki, wenn „Vom Winde verweht“ lief. Scarlett bittet Rhett Buttler um Verzeihung, da verwandelte sich das Kino in einen Tränenpalast. Auch bei „Alexis Zorbas“. Der Sirtaki in der Schluss-Szene schlägt ein ins Tränenmodul wie eine Sturmflut.
Hindemith, Orff, Prokofiews beide Violinkonzerte, Schostakowitschs 5. Sinfonie, Bartoks 3. Klavierkonzert und sechs Streichquartette, Bergs Violinkonzert und „Wozzeck“, Schönbergs Gurre-Lieder, Violinkonzert, Variationen für Orchester, Hanns Eislers Deutsche Sinfonie, Boris Blachers 2. Klavierkonzert, Fortners Movements, Höller, Ligeti, Lutoslawski, Stockhausen, Britten, Elgars Violinkonzert, Pendereckis Lukas-Passion … das waren meine Helden der Gegenwart. Erst viel später kamen Karl Amadeus Hartmann, Conlon Nancarrow, Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke, Kancheli, Eötvös, Kurtag, Rihm, Moiret und andere hinzu.
Schütz, Purcell, Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak, Tschaikowsky, Debussy, Ravel, Bruckner, Mahler, Richard Strauss … das waren die alten Helden. Verdi kam mit der Oper dazu. Wagner auch, aber über „Lohengrin“, den ich in Texten und Bildern schon in der Kindheit durch meinen Großvater kennengelernt hatte, kam ich lange Zeit nicht hinaus. „Nie sollst du mich befragen“ war eine stehende Redewendung meines Großvaters, meist im ehelichen Disput mit Mama Louise. Zum „Ring“ kam ich erst in den 90er Jahren, zu „Tristan“ früher. „Parsifal“ ist die schönste Entdeckung. Ich las um die Jahrtau-sendwende den „Zauberberg“ mit meinen Schülern, da passte beim Durcharbeiten an meinem Schreibtisch die Musik zum Kapitel „Fülle des Wohllauts“. Ich dachte zurück an eine Zeit meines Studiums, in der ich mich dem Stumpfsinn des Nichtstuns hingab und richtungslos lauter unnütze Dinge tat: Ich zählte meine Bücher, damals waren es nicht mehr als 300, schrieb Statistiken über Reichstagswahlen, verglich die Literatur-Nobelpreisträger und las einen Science-Fiction-Roman nach dem anderen, statt in der Universitätsbibliothek die Literatur über deutsche Militärdoktrin vor und nach dem Ersten Weltkrieg auszuwerten. Damals war ich wie Castorp im vorangehenden Kapitel: „Der große Stumpsinn“. Das freie Spiel aller geistigen Kräfte findet auf vielen Feldern statt, leider auch auf dem Schlachtfeld, wo Castorp fällt. Thomas Mann begleitet den Tod des kritisch geliebten Scheiterers mit Schuberts Lied vom Lindenbaum … Und nun gewinne ich, so manches Mal ein zweiter Castorp, seit zwei Jahren „Die Meistersinger“, die zu hören ich ein Leben lang zögerte, in der Furcht vor deutschtümelnder Folklore. Aber die Musik fließt und tanzt so leicht dahin wie in keiner anderen Wagner-Oper.
Ich lese demnächst Thomas Manns „Doktor Faustus“ noch einmal, darin sind so viele Musik-Bezüge wie in keinem anderen Roman. Thomas Manns These, dass die Musik der Deutschen Wurzel und Kommentar ihres (!) Untergangs sei, teile ich nicht. Die Assoziation liegt verführerisch nah, und ein wenig ist ja auch dran – Heine sagt im „Wintermärchen“: Man schläft so gut in deutschen Betten… Der verschlafene, naive Michel, die Egozentrik deutscher Außenpolitik seit Bismarck, den ich in Grund und Boden verurteile, auch innenpolitisch.
Es ist wohl eine große Sorge aller jungen Generationen, als spießig zu gelten. Die größten und zugleich ärmsten Verrenkungen beobachtete ich bei Schülern in der oft weit ausgelebten Ära der Reifung zum Erwachsenen, aber auch wieder im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, wo viele Angst haben (müssen), letztlich doch wie ihre Eltern zu werden… Es gibt eine wohltuende Normalität und Regularität, die unsere Kräfte nicht vertändeln lässt in unnützen und oft vergeblichen Abwehrkämpfen gegen das So-sein-wie-andere. Wirkliche Individualität gibt es nur durch das Tun. Die Anbindung der Person an bestimmte Vorgaben (Musik hören…) reicht da kaum aus. Es sind hilflose Versuche, sich über Musik zu definieren. Das habe ich auch nicht mit diesem Text versucht, also meiner Erinnerung an ein mir zwar wichtiges, aber wenig beweiskräftiges Konsum-verhalten.
Ach… Mir tut die Beobachtung weh, dass sich so viele junge Leute durch zwei Jahrzehnte Industriemusik durchfressen, ehe sie Bob Dylan und Bach und Co. finden. Die meisten aber gaffen hinauf zu Lady Gagas Venusberg oder saufen sich in Pop-sentimentalismen müde. R. I. P.
***
Der kleine Wagnerianer: Zehn Lektionen für Anfänger und Fortgeschrittene, von Enrik Lauer und Regine Müller
Weiterfühend →
Flankierend zum Kollegengespräch eine Leseprobe aus Der kleine Wagnerianer, die der Beck-Verlag aus dem Buch zur Verfügung stellt. Eine andere Lesart präsentiert Ulrich Bergmann auf KUNO.