Francisca Ricinski: Vor einiger Zeit lasen Sie im Arp-Museum von Rolandseck Fragmente aus Ihrem Roman „42“. Dieser Titel wurde in den Medien unterschiedlich gedeutet und mit einigen Werken in Verbindung gebracht, wo diese symbolträchtige Zahl auftaucht. Mir fällt spontan Sarah Kanes letztes Theaterstück „4.48. Psychose“ ein. „Um 4h 48 werde ich schlafen“ und „ändre die Welt durch eine silberne Finsternis“ kündigte mit der Stimme ihrer kranken Protagonistin die junge englische Dramatikerin an, die kurz darauf Selbstmord beging.
Um 12 Uhr 47 ereignet sich in Ihrem Roman eine erschreckende Anomalie, genau in dem Augenblick, als eine Gruppe von Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten, die das Genfer Forschungszentrum CERN für Teilchenphysik besichtigt hatten, aus dem Fahrstuhl steigt. Die Zeit bleibt an jenem heißen Augusttag in der 42. Sekunde stehen und die Menschen, mit Ausnahme der von Ihnen als „Chronofizierten“ getauften, erstarren wie durch einen bösen Zauberspruch.
Zwar weisen diese zwei Titel keinerlei Zusammenhänge auf, wohl aber eine äußerliche Verwandtschaft, durch eine ähnliche Option für die Ziffer 4 und die Nachbarschaft der Minuten. Daher meine Frage: Weshalb 42, sei sie eine mystische oder nur eine beliebige Zahl? Was will sie versinnbildlichen?
Thomas Lehr: Die Zahl 42 hat sich zunächst allein aus dem Werkzusammenhang ergeben. Zuvor hatte ich die Novelle „Frühling“ publiziert, die die letzten 39 Sekunden im Leben eines Selbstmörders schildert. Der Roman „42“ beginnt mit einem dreisekündigen Wiedereinsetzen der Zeit, das die Protagonisten nach 5 Jahren „Unzeit“ veranlasst, wieder in Genf zusammenzukommen. 39 plus 3 ergab 42 – und damit hatte ich die Sekunde, in der die Zeit still stehen konnte, eine Sekunde, die nicht zufällig auch den Übergang vom Sterben zum Tot-Sein markieren sollte, denn eine der möglichen Interpretationen des Buches ist, dass die Figuren in der Zeitlosigkeit existieren, weil sie sich im Übergang ins Jenseits befinden. Dann entdeckte ich in einer Studie von Florian Coulmas über die Zeit in Japan, dass man in Japan bei Fotografien für Uhrenwerbungen den Minutenzeiger nicht auf „42“ stellen darf, da man „42“ als „shi ni“, das heißt „tot sein“, lesen kann. Das hat mich sehr begeistert – und schließlich kam noch das mir damals noch unbekannte Buch von Douglas Adams hinzu, auf das mich der Verlag hinwies, kaum als ich mein Manuskript abgegeben hatte. Demnach ist „42“ die Antwort eines Superrechners auf die Frage nach dem Sinn des Universums. Besser konnte es nicht kommen…
F. Ricinski: Fünf Jahre lang lebt die davongekommene Gruppe in der Unendlichkeit eines einzigen Tages unter der ewigen Mittagssonne, bevor die Welt sich auf wundersamer Weise nochmals in Bewegung setzt. Was die 70 „Auserwählten“ in den fünf Jahren durchleben, schildert uns der Journalist Adrian. Die Ereignisse werden in fünf Phasen zusammengefasst. „Schock“ nennt er den Anfang. Sind die darauf folgenden Phasen – Orientierung, Missbrauch, Depression und Fanatismus – nicht mindestens so schockierend wie die erste, wenn nicht sogar mehr? Besonders im Hinblick auf das gestörte Sozialverhalten und die Moraldekadenz einer Menschheit, die im Handlungsverlauf mit ihren Begreifbarkeitsgrenzen und der Erfahrung ihrer Ohnmacht konfrontiert werden?
Th. Lehr: Am Anfang reizte mich an dem Roman-Konzept vor allem die Möglichkeit, in einem Kunstwerk durch das märchenhafte, absurde Setting die Gelegenheit zu haben, über Zeit und den Zeitbegriff zu philosophieren und philosophieren zu lassen. Aber während der Arbeit an dem Buch erkannte ich bald das zweite Hauptthema, das soziale oder soziologische Grundthema. Mit der Frage, was die 70 Chronifizierten mit der ihnen ohnmächtig ausgelieferten Welt anfangen, befand ich mitten in einem sozialpsychologischen Experiment. Die fünf Phasen, die den Roman einteilen, gemäß den „Sperberschen Gesetzen“, die eine der Figuren zu Anfang aufstellt, sind die Stationen einer pessimistischen Anthropologie der Macht, zu der ich beim Nachdenken wohl gekommen bin.
F. Ricinski: Was Sie über die Welt erzählen, die innerhalb einer Sekunde aus den kosmischen Fugen gerät, mag vordergründig ein Fantasiespiel zu sein. Heraklits Lehre, alles im Fluss zu sehen, scheint jedenfalls leichter nachvollziehbar zu sein, als der Stillstand der Zeit. Andererseits, wenn die Physiker beim Urknall den Anfang von Raum und Zeit sehen, neigt man dazu, auch über die Endlichkeit dieser Kategorien nachzudenken. Für den Leser, der sich auf dieses „Spiel“ einlässt, können das wissenschaftliche Gerüst und die Dramaturgie dieses Störfalls durchaus plausibel klingen. Es sind aber nicht nur die physikalischen Gesetze, die von Ihrer Schreibkunst außer Kraft gesetzt werden. Hinter der Fiktion verbirgt sich meines Erachtens die gnadelose Satire eines Mahners und Visionärs. An manchen Stellen wirkt Ihre Darstellung wie ein Szenario von biblischen Ausmaßen. Würden Sie einer solchen Parallelität zustimmen, auch wenn das Unglück in Ihrem Roman nicht durch Gottes richtende Hand, sondern infolge vermuteter Maßlosigkeit des Menschen und seines Hochmutes geschieht?
Th. Lehr: Jetzt haben Sie meiner „pessimistischen Anthropologie“ eine vielleicht zu große, zu apokalyptische Dimension verliehen. Die Ausmaße einer kosmischen Katastrophe hat natürlich die Kulisse der stehengebliebenen Zeit und der komplett erfrorenen Welt. Dagegen wirkt die Zahl der noch handlungsfähigen Figuren sehr kammerspielhaft. In dieser gegensätzlichen Dimension kann ich – hoffentlich – sehr große Themen mit einem gewissen Understatement und einem gewissen Humor gestalten. Denn die Frage, die sich beim Fortlesen immer wieder stellt, ist doch, wie „wirklich“ das Szenario ist, in dem sich die Figuren bewegen. Hierfür findet der Roman eine Folge von ziemlich bodenlosen Antworten und definiert sich selbst immer mehr als fiktiv und metaphorisch. Es ist mehr das Denkspiel, das mich reizt, als die Schockwirkung eines apokalyptischen Gemäldes.
F. Ricinski: Während Faust den schönen Augenblick anfleht zu bleiben, bringen Sie die Zeit in Ihrem Roman quasi grundlos und unbegreiflich zum Stillstand. Welche Zeit aber? Oder verändern sich nur die räumlichen Lagen der Körper? Anscheinend ist nicht von der Dauer oder Beständigkeit die Rede, so wie Newton oder Henri Bergson sie verstand, sondern eher von einer relativen, gewöhnlichen Zeit. Bei Proust zumindest findet Marcel die verlorene Zeit in der Erinnerung wieder. Sie aber nehmen Ihren aus der Zeit gefallenen, im eigenen Körper gefangenen Figuren auch diese Illusion weg. Es gibt aber nicht nur die Erinnerung. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereinen sich ständig im Augenblick. In der fatalen 42. Sekunde lassen Sie dieses dreifache Jetzt einfrieren. Gibt es eine größere Tragik als die noch nicht angebrochene Zukunft zu verhindern oder als den Menschen wie „komatöse Puppen“, „eingepökelt in den Aspik der Luft“ erscheinen zu lassen? Kann eine entseelte Welt überhaupt bestehen? Wieso geben Sie Ihren Protagonisten noch eine Chance oder die Illusion dieser Chance, indem die Welt sich für drei Sekunden weiter dreht? Damit sie ihre niedere Haltung erkennen? Um ihnen die Relativität aller Dinge und die Brüchigkeit dieses Lebens begreiflich zu machen? Wie finden Sie diese Aussage aus „Die Zeit“, dass „42 die direkte Übersetzung der Einsteinschen Relativitätstheorie in der Literatur ist?
Th. Lehr: Die letzte Frage aus der Zeit-Rezension trifft schon den Kern des Buches, wenn man darunter das zutiefst Relative der Chronifizierten im Vergleich zu der riesigen erstarrten Welt um sie herum versteht. Auch die Konsequenzen der Relativitätstheorie für den Zeitbegriff (das ist zum einen die Abhängigkeit der Zeit von der Bewegung in der Speziellen Relativitätstheorie, zum anderen die Abhängigkeit der Zeit von Gravitation bzw. Masse in der Allgemeinen Relativitätstheorie) sind immer wieder Thema des Romans – manchmal auf einer sehr ernsthafte, manchmal auch auf komische oder groteske Weise.
Die Tragik des Ganzen empfindet man nur, wenn man das Setting als realistische Kulisse glaubt. So beginnt der Roman natürlich, um den Bann auf den Leser zu werfen. Aber wie gesagt, beim Hindurchschreiten wird ja diese bleierne Welt durch die Hypothesen und Theorien der Figuren immer fragwürdiger und transparenter, bis am Ende das Spiel die Oberhand gewinnt: als Gelegenheit, einmal die Fragen von Zeit und Raum in einer veritablen Grenzsituation zu überdenken. Und als Gelegenheit, unsere hyperaktive Gesellschaft in einem meditativen Zustand einmal genauer zu beobachten als ihr vielleicht lieb ist.
Dass ich die Zeit für drei Sekunden zu Beginn des Romans weiterticken ließ, war vor allem ein dramaturgischer Kunstgriff. Der „Ruck“, der durch die erstarrte Welt ging, ist der deus ex machina, der die Handlung vorantreibt, indem die Figuren nach Genf ans CERN zurückkehren, weil sie eine Manipulation der Zeit von dort aus vermuten.
F. Ricinski: Wie würden Sie persönlich den Zeitbegriff erklären? Geben Sie dem Heiligen Augustinus Recht, wenn er sagt: „Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Werde ich aber danach gefragt und will ich es dem Frager erklären, dann weiß ich es nicht“?
Th. Lehr: Die Zeit-Stelle in den „Bekenntnissen“ ist einer der großartigsten Texte, die wir in der abendländischen Philosophie zu diesem Thema haben. Klar ergeht es mir oft wie Augustinus – und weil es mir schon immer so ergangen ist, wollte ich dieses Buch schreiben. Ein Roman, an dem man viele Jahre arbeitet, ist wie ein (relativ) Endlos-Seminar mit sich selbst, und für gewöhnlich klären sich durch das Nachdenken und die Lektüre viele Dinge. Ich habe viel über die Zeit gelernt, sowohl unter philosophischen als auch unter physikalischen Aspekten. Das im Einzelnen zu sagen, will ich hier lieber nicht versuchen, denn dafür gibt es ja schließlich diesen Roman, in den ich alles hineingepackt habe, was ich lernen und in genießbarer Form an den Leser weitergeben konnte. Den einfachsten und besten Satz, der mir im Laufe der Arbeit eingefallen ist, will ich aber zitieren: „Zeit ist der Abgrund, in den wir fallen, seit dem Augenblick unserer Geburt.“
F. Ricinski: Ohne sich in eine Obsession zu verwandeln, bleibt dennoch die Zeit ein wichtiges Thema Ihrer Bücher, auch wenn in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen. In dem thrillerartigen Roman „Zweiwasser oder Die Bibliothek der Gnade“ erwachen die Helden der Ilias nach einem mehr als dreitausendjährigen Schlaf zu neuem Leben, um als Autoren, Verleger und Kritiker sich für Erfolg, Macht, Reichtum und Liebe zu bekämpfen.
Die erotische Beziehung des provinziellen Künstlergenies Georg Graf zu seiner Muse Camille wird in „Nabokovs Katze“ über einen Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren erzählt. Von Sekunden ist auch in Ihrer meisterhaften Novelle „Frühling“ die Rede: Von den neununddreißig Sekunden (erfasst in neununddreißig, rückläufig nummerierten Kapiteln), die Christian Rauch braucht, um sein Leben nochmals durchzugehen. Nicht das gefrorene Jetzt, wie im Roman „42“, sondern die ungeheuerliche Vergangenheit hält ihn gefangen. Wie ein Fluch. Es gibt kein Entrinnen für die zwei Söhne des Arztes, der im Konzentrationslager Dachau Experimente an Häftlinge durchgeführt hatte, außer im Tod. Der siebzehnjährige Robert zerbricht an der höllischen Wahrheit, die er im Garten aus dem Mund eines Überlebenden erfährt und ans Licht bringt, der fünfzig Jahre alter Christian an dem nie unüberwundenen Trauma und eigenen Scheitern. Erst während des Sterbens scheint für diesen „Verdammten“ die Tortur der Zeit aufzuhören.
Von daher vielleicht der Titel und das Motto dieser Geschichte, das aus Dantes Göttlicher Komödie stammt, über das Jenseits als der wunderbarste Frühling? Können Sie den Lesern unserer Literaturzeitschrift Näheres darüber erzählen? Auch bei Strawinsky in „Sacre du printemps“ erscheinen Tod und Frühling untrennbar verbunden, auch wenn mit einer ganz anderen Symbolik.
Th. Lehr: Ich habe Zeit und Zeitbegriff immer wieder zum Gegenstand meiner Bücher gemacht und in jedem Buch einen neuen, originellen oder wenigstens interessanten Umgang mit dem Zeitparameter im Erzählmuster gesucht. Denn als Grundtatsache bleibt ja, dass jedes literarische Werk, insbesondere natürlich der Roman, zweifach mit der Zeit arbeitet, zunächst indem es darstellt, was in der symbolischen (oder besser: symbolisierten) sozialen Zeit der Figuren geschieht, und dann, indem es sich für eine Abbildungsform der fiktiven sozialen Zeit in die reale und weitgehend lineare Eigenzeit des Lesers entscheidet (Faltung, Dehnung, Perforation, Verschachtelung der symbolischen Zeit). Vom thematischen Zugriff her hat mich in meinem ersten Roman „Die Erhörung“, vor allem der Versuch gereizt, einen großen Geschichtsraum (1918-1986) zu umfassen und in Simultanbeziehungen zu setzen. Das Buch enthält einiges an geschichtsphilosophischer Reflexion. Im Roman „Zweiwasser“ interessierte mich Zeit vor allem unter dem Heraklitschen Aspekt, dem fortwährenden Verbrennen der Gegenwart, die Tatsache eben, dass Zeit für uns als physikalischen und biologischen Körpern immer im strengen Newtonschen Sinne des stetigen Flusses gegeben sein wird, der uns aus dem Wege räumt. Das ist etwas, wogegen der Geist protestiert und anlebt, in dem er die Synthese der Zeit-Ekstasen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft leistet – also gegen den Strom ankämpft mit Erinnerung, Erzählung, versuchter Vorhersage, Erfindung unmöglicher Zusammenhänge, Faltungen von Zeit und so fort. Die bedeutsame Rolle der Literatur in diesem Kontext wird deutlich hervorgehoben.
In dem Roman „Nabokovs Katze“ hat mich insbesondere der Umgang mit lebensgeschichtlicher Zeit fasziniert. Er ist ja eine Art Education sentimentale meiner Generation, eine relativ kontinuierliche Beobachtung des Älterwerdens, der Veränderung des Individuums in der Zeit. Der Held ist Regisseur, und sein professioneller Umgang mit den bewegten Bildern, dem Medium Kino, spiegelt sich in Beobachtungsformen seiner eigenen lebensgeschichtlichen Realität. Insofern war das erzähltechnische Spiel mit der kinematographischen Zeit-Modellierung sehr probat, „cineastische“ Techniken werden eingesetzt wie Überblendung, Fragmentierung, Zeitlupen und Zeitraffer, Vorblenden und Split screens.
Im schmalen Rahmen der Novelle „Frühling“ habe ich wegen der extremen Erzähl-Situation Zeit-Techniken am stärksten eingesetzt, eigentlich in Fortentwicklung der Arbeit an „Nabokovs Katze“. Das gelang vor allem auch durch die Verwendung von verschiedenen Orthografien oder orthographischen Störungen, mit denen sich verschiedenen Zeitebenen (die Selbstmord-Szene im Frühling 2000, die Kindheit in den 60-er Jahren, Lebenszeit-Rückblenden in verschiedene Alter) blitzartig hintereinander oder ineinander schachteln ließen, fast wie Tonart-Wechsel in der Musik. Das Motto des Buches: „Ich sah ein Licht in Stromesform sich gießen/Und flüssigen Glanzes voll im Bette ziehn/Und dran den wunderbarsten Frühling sprießen“ stammt aus dem 30. Gesang des Paradieses der „Göttlichen Komödie“. Dieser Frühling ist weit jenseitig. Der leuchtende Fluss ist sogar noch eine Illusion, „ein schattiges Vorspiel zur Wirklichkeit“ – und formt sich um zum Stiel der berühmten Himmelsrose, in deren Blüte Dante dann Gott erblicken darf.
Im historischen Diesseits der Novelle haben wir den Frühling in Dachau. Er ist beeindruckend schön, gerade auch im historischen Hofgarten des Schlosses, in dem auch die letzte Sekunde der Novelle spielt. Nicht umsonst wurde das Dachauer Moos bereits in den 40-er und 50-er Jahren des 19. Jahrhunderts und verstärkt nach 1870 zum Anziehungspunkt bekannter Maler: Spitzweg, Liebermann, Corinth, Dill, Hölzel haben hier gemalt, und Dachau wurde nach Worpswede zur bedeutendsten deutschen Malerkolonie. So ist es kein Wunder, wenn der Dachauer Frühling immer wieder in den Zeugnissen ehemaliger KZ-Häftlinge auftaucht – als schmerzvolles Paradox, das ihre Hölle nur umso tiefer erscheinen ließ.
Zu „42“ muss ich an dieser Stelle nur anmerken, dass es eben das Buch ist, in dem ich zum ersten Mal das Zeitthema ganz explizit angehen wollte. Die Zeit als Held eines Romans, das war die grundlegende Idee.
F. Ricinski: Die so wechselhafte Affektlage von Christian, der sich in einem diffusen Wahrnehmungszustand zwischen Schon und Noch Nicht befindet, spiegelt sich in einer perfekt adäquaten Wort- und Satzkunst und in allen vorstellbaren Tempi, Temperaturen und Klangfarben wieder. Es gelingt Ihnen eine seltene Korrespondenz zwischen den unterschiedlichen Phasen des schlängelnden, zersplitternden oder geronnenen Monologs Ihrer Ich-Figur und den dafür eingesetzten Ausdrucksformen und Stilmitteln, mit verblüffender Wirkung. Ich sehe in Ihrer eigenwilligen Interpunktion bzw. Zerstörung der Syntax keinerlei sterile spätavantgardistische Experimente oder unzumutbare Spielereien. Auch bestehen manche Stellen Ihres Romans „42“ nicht ohne Grund oder Absicht aus wuchernden Perioden, die nicht mehr aufhören wollen.
Einige Kritiker und Rezensenten behaupten, dass Ihr gewagter Umgang mit der Sprache und den tradierten Normen sowie die vielen Fremdwörter, Symbole, unbekannten Begriffe das Verständnis Ihrer Bücher erschweren oder sogar den Leser abschrecken. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem literaturinteressierten Publikum bei Ihren zahlreichen Lesungen und Begegnungen?
Th. Lehr: Es freut mich sehr, dass Sie im ersten Teil Ihrer Frage schon so gut beschreiben, weshalb ich manchmal – und im Laufe meiner Schreibarbeit auch immer stärker – diese avancierten Methoden verwende. Es hat mit Spielerei wirklich nichts zu tun. Ich habe einigermaßen konservativ mit einem an den Meistern des 19. Jahrhunderts geschulten präzisen Realismus begonnen und mich danach mit den Inhalten formal weiterentwickelt. Von Anfang an hatte ich die Idee, die klassischen Methoden zu beherrschen und nur dann weiterzugehen, wenn ich eine Notwendigkeit dazu sah. Die hat sich auch ergeben, und so ist meine formale Eigenwilligkeit glaube ich sehr ernsthaft und elaboriert.
Im Allgemeinen verstehen das sowohl die Kritiker als auch das Publikum – was mich sehr angenehm überrascht hat. Ich denke, sie sehen, dass es funktioniert, dass man den Effekt der Bücher nicht mit anderen, einfacheren Methoden erzielen kann. Bei „42“ und bei „Frühling“ gibt es aber auch Abstoßungen. Ich kann nichts daran ändern, denn die Form meiner Bücher ist kein Zufall, sondern entwickelte Notwendigkeit. .
F. Ricinski: „Bei meiner Selbstbegründung als Künstler hat mich Flaubert enorm geprägt“, haben Sie einmal gesagt. Erkennen Sie auch andere Meister und Wahlverwandte an?
Th. Lehr: Aber gewiss. Nabokov habe ich auf den Titel meines dritten Romans geschrieben. Die Robert-Musil-Spuren sind wohl auch unverkennbar. Goethe und Thomas Mann, Rilke, Kafka, Updike, Claude Simon – ach, mir fallen so viele Meister ein. Ich musste wirklich nicht vom Himmel fallen, die Literatur ist schier unerschöpflich an Vorbildern. Die Frage ist eher temporär: Wen, welche hohe Schule, lässt man in einer bestimmten Schreibphase nah an sich heran?
F. Ricinski: Was verbindet Sie mit den Schreibkollegen Ihrer Generation? Was unterscheidet Sie?
Th. Lehr: Ich kenne viele meiner Kollegen persönlich und bin mit einigen wenigen befreundet. Uns verbindet schon allein die Generationserfahrung und die Marktsituation und oft auch – zumindest bei meinen Freunden – gewisse Grundstandards der Literaturauffassung. Ansonsten bin ich hier lieber Objekt der Frage. Die Literaturwissenschaftler werden das besser sagen können, sofern sie meine Arbeiten für begutachtenswert halten.
F. Ricinski: Wo geht I.E. die Literatur unserer Zeit, vor allem der aktuelle Roman, hin? Machen sich neue Strömungen und innovative Formen bemerkbar?
Th. Lehr: Ich habe keinen Überblick, ich versuche aber sehr wohl, neue Formen, neue Tendenzen zu schaffen. Dabei schaue ich weniger auf meine aktuellen Kollegen als auf einzelne große Schriftsteller, deren Innovationskraft mich inspiriert oder deren Formen ich wiederverwenden oder modifizieren kann.
F. Ricinski: Warum, glauben Sie, hat die Lyrik an gesellschaftlicher Bedeutung verloren und vermag nicht mehr, an ihren Glanzzeiten anzuknüpfen?
Th. Lehr: Lyrik war immer an eine gewisse Salonkultur gebunden, und die gibt es kaum mehr. Ob die zahlreichen Poetry-Events ein sinnvolles Gegengewicht herstellen, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht gehört das kleine, „erlesene“ oder „belesene“ Publikum auch unabdingbar zur Lyrik. Selbst in den Zeiten der Weimarer Klassik kann man kaum von einer „Breitenwirkung“ sprechen.
F. Ricinski: An welchem Werk arbeiten Sie zurzeit? Hat es schon einen Titel? Wann wird es in den Buchhandel kommen?
Th. Lehr: Gerade erschienen ist mein erster Roman für Kinder, eine Mischung aus James-Bond und Alice im Wunderland mit dem Titel „Tixi Tigerhai und das Geheimnis der Osterinsel.“ Das war eine erfrischende und lustige Nebenarbeit zu einem umfangreichen Roman, an dem ich seit drei Jahren arbeite, der wohl gegen 2010 erscheint – und über den ich hiermit gar nichts gesagt haben wollte …
F. Ricinski: Ich danke Ihnen, lieber Thomas Lehr, für dieses Gespräch und wünsche all Ihren Büchern eine große Resonanz und dauerhaften Erfolg!
***
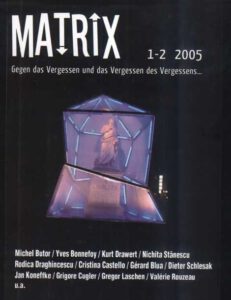 Das Gespräch erschien zuerst in Matrix 2/ 2008.
Das Gespräch erschien zuerst in Matrix 2/ 2008.