Es ist sonntagmorgens, fünf nach zehn, und Günther Kimmerle ist unausgeschlafen. Er betrachtet sich im Spiegel, während er sich rasiert. Er sieht schlecht aus. Die Augenränder sind gerötet, die Tränensäcke geschwollen. Geplatzte Blutgerinnsel zersetzen die Iris. Zwischen den Augenbrauen und um den Mund herum kräuseln sich Fältchen.
Günther Kimmerle hasst dieses Gesicht. Es gehört ihm nicht, es ist ihm fremd. Wenn er in den Spiegel sieht, erwartet er, ein anderes zu sehen. Nämlich das Gesicht des kleinen Jungen, der er war. Vielleicht dreizehn Jahre alt, vielleicht auch älter. Dieses Bürschchen, das düster blickende Grimassen vor dem Spiegel schneidet und den Helden der Fernsehserie nachahmt, die es seit zwei Jahren gewissenhaft verfolgt. Ein Jüngling, der ungeduldig den blondrötlichen Schatten über den Lippen mustert und sich über die Pickel ärgert. Er weiß, er selbst wird eines Tages verschwunden sein und an seiner Stelle wird ihm im Spiegel das Gesicht des Erwachsenen, des tapferen Günther Kimmerle erscheinen, der zu dem Zeitpunkt in der Zukunft möglicherweise schon viel mehr erreicht haben wird als der Held der TV-Serie. Darauf wartet er. Mit jedem Blick in den Spiegel erwartet er, das Gesicht des zukünftigen Günther Kimmerle endlich zu sehen.
Es erübrigt sich zu sagen, dass die Blicke des Jünglings und die des Erwachsenen sich im Spiegel nie gekreuzt haben. Die beiden sind sich nie begegnet. Das liegt nicht allein an physikalischen Phänomenen wie Zeit und Raum. Es ist hauptsächlich die Folge eines Missverständnisses, das die beiden auf parallel laufende Bahnen führt und parallel existierende Erwartungen hegen lässt.
Was der erwachsene Günther Kimmerle erwartet, ist, jenes Gesicht im Spiegel zu erblicken, das er an einem gewissen Abend, als er sich die Zähne putzte und, wie üblich, Grimassen vor dem Spiegel schnitt, zum ersten Mal als sein eigenes wahrgenommen hatte. Er will jenen intensiven Augenblick bewusster Selbsterkennung wieder erleben. Die Verwunderung darüber, dass er ist. Er will das Ur-Gesicht zurück, das vor dem Erkranken an illusorischen Visionen und aberwitzigen Selbstprojektionen. Es ist ihm an jenem Abend kurz erschienen. Er musste innehalten und hinsehen.
Das Gesicht im Spiegel betrachtete das Gesicht vor dem Spiegel. Es gab diesen Abstand zwischen ihnen, der Ruhe in die Betrachtung brachte. Sein Blick begegnete dem Blick im Spiegel.
Dann trennten sie sich. Sein Blick glitt abwärts über die schmächtige Gestalt, die vor ihm zitterte, wanderte langsam hoch und fing den Blick im Spiegel wieder auf. In jenen Augenblicken, so wundersam flüchtig zwischen Entzweiung und Wiedererkennen, fühlten sich Stolz, Neugierde und Rebellion sanft an, beinahe zart. Sie taten nicht weh, sie demütigten ihn nicht. Wie schläfrige, gesättigte Raubkatzen kuschelten sie in seiner Nähe, reckten sich anmutig, streiften seine Haut mit seidigem Fell, berührten seine Wange mit weichen Pfoten. Er wusste, sie würden ihn nicht angreifen, sondern beschützen wollen. Die Angst wogte in ihm berauschend und süß. Sie wiegelte die Sinne auf, brachte den Körper in trunkenen, zweckfreien Aufruhr.
Für Günther Kimmerle – Augenblicke ohne Wiederkehr.
Er steht in Unterhose vor dem Spiegel und mustert verständnislos den Fleck, der sich vor seinen Augen über die undurchdringliche Oberfläche ausbreitet. Der Fleck hat die Züge seines Gesichts, diese sind ihm aber unbekannt. Die Vermisstenanzeige eines Fremden, das ist es, was er heute im Spiegel sieht. Heute und gestern und vorgestern und seit vielen Jahren. Die Sinnesorgane sind taub und stumm, sie verraten ihm nichts, weihen ihn nicht ein. Sie kehren ihm den Rücken. Scher dich zum Teufel!
Die Haut sieht nach dem Rasieren wie bei einem gerupften Huhn aus, die Poren körnig und gerötet. Er tupft sie mit After Shave. Er mag den Duft. Gerüche kann er noch gut leiden. Nicht alle. Die eigenen nur selten und schon gar nicht, wenn sie sich unter die anderer mischen, wenn die Anderen ihn überrumpeln. Er kann in solchen Augenblicken die Impulse der Sinne nicht zuordnen.
Er macht das Licht aus und verlässt das Badezimmer.
Er ist müde, obwohl er einige Stunden trotz des fremden Bettes und des anderen Körpers, der neben ihm lag, geschlafen hat. Er hat schlecht geträumt, ist erschöpft aufgewacht, hat sich aus dem Bett geschlichen und ist gegangen, ohne die Frau zu wecken.
Zu Hause hat er ausgiebig gefrühstückt, Zeitungen gelesen, Radio gehört. Ablenkung oder Tätigung, egal: Was immer er sich von diesem morgendlichen Ritual erhofft hat, es ist nicht eingetroffen.
Betäubt vor Müdigkeit, musste er den Gedanken ertragen, es wäre ihm wieder einmal misslungen, ganz in sich zu wohnen, im eigenen Körper aufgehoben. In der Dusche verharrte er unter dem eiskalten Wasserstrom, um die sich seiner bemächtigende, alles beherrschende Taubheit zu vertreiben. Sie ließ sich nicht vertreiben. Sie war, ist und wird da sein und ihm alles versauen. Wie in der vergangenen Nacht auch, die Begegnung mit Karin oder Katharina oder wie sie heißt, er kennt sie ja kaum. Sie hat schöne Brüste, an deren Duft kann er sich erinnern.
Günther kriecht ins Bett und schließt die Augen. Er hat keine Lust zu wissen, wer diese Frau ist. Er hat keine Lust, dass sie weiß, wer er ist. Er weiß es selber nicht. Sein eigener Körper ist ihm zum lästigen Anhängsel geworden. Ein schäbiger, knurrender Hund, den er regelmäßig mit Schlaf, Fraß und Leibesfreuden füttert, in der Hoffnung, er würde sich dankbar erweisen.
Er dreht sich auf die Seite, zieht die Knie zum Mund. Er spürt keine Erleichterung. Warum auch, er versteht es sowieso nicht. Er versteht nicht, was ihm geschieht, wenn er in einer Frau ist. Was geschieht, wenn er sich entzweit, mit den Reflektionen seines Wesens, diesen Zwillingserscheinungen, die sich voneinander entfernen, als stünde er zwischen zwei Spiegeln, die seine Duplikate ins Unendliche projizieren. Jedes unter den Ebenbildern seines Wesens würde am liebsten wissen, was die anderen von seinesgleichen spüren, und vergessen, was es selbst spürt.
In dieser Nacht war es nicht anders. Dem Geschmack des Spürens konnte er nicht bis zu Ende folgen. Der Verstand hat ihn eine Weile begleitet und mit Informationen gefüttert. In dem Augenblick aber, in dem er sich allein auf seine Sinne hätte verlassen und diese ihm selbstständig hätten etwas senden müssen, sind sie in der Unendlichkeit der Selbstwiederholungen zerlaufen, haben sich in deren Leiber zerstreut und ihn allein gelassen. Allein mit dem Hund, der knurrte, keuchte und rammelte und nichts von dem, was er tat, mit ihm teilte. Günther hatte keine Ahnung, wo der hin eilte, wovon er fliehen wollte, ob er glücklich war.
Er ging von sich selbst und dem Hund weg, beobachtete stattdessen die Frau, die so weit entfernt unter seinem Körper stöhnte. Diese Entfernung hat ihm eine eisige Angst eingejagt, die Angst vor dem Nichtsein und dem Lächerlichen dieses Tuns in Abwesenheit seiner selbst.
Die Angst vor der Unermesslichkeit des Verrats.
Der Verrat kommt unwiderruflich, was immer er auch tut. Wie innig er ihn auch anfleht, dieser Hund von einem Körper verrät ihn immer. Der Hund, der in seinem fremden, erwachsenen Leib die Zähne fletscht.
Man schuldet allein dem Kind Rechenschaft, dem Kind, das man einmal war, denkt Günther Kimmerle und schläft ein.
* * *
Eine Leseprobe aus: Abhauen, Roman von Ioona Rauschan, 336 Seiten, Pop Verlag, Ludwigsburg 2008.
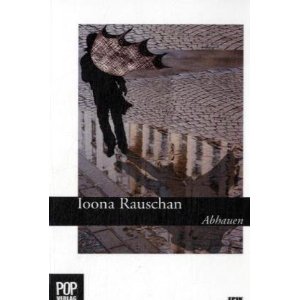
Auf der Schwelle. Ein Filmessay über Heinrich Heine von Ioona Rauschan. Edition Biograph, 1997
Die schöne Strickerin, Novelle von Ioona Rauschan, Edition Biograph, Düsseldorf 1995. (Antiquarisch erhältlich).
Weiterführend →
Ein Kollegengespräch mit Ioona Rauschan findet sich hier. Das Live-Hörspiel 5 oder die Elemente wurde in der Regie von Ioona Rauschan mit Marion Haberstroh und Kai Mönnich im Gutenberg-Museum zu Mainz uraufgeführt. Señora Nada, in der Regie von Ioona Rauschan, ist auf Hörbuch Gedichte erhältlich. Probehören kann man das Monodram Señora Nada in der Reihe MetaPhon.