Ein Freund von mir sammelt Schrebergärten.
Erst war dieser Tick nicht weiter aufgefallen, denn als Michael mit seiner Familie in unseren Stadtteil zog, übernahmen sie den Schrebergarten von den Vormietern. Der befand sich praktischerweise ganz in der Nähe ihres neuen Hauses, und diente der Familie zum Anbau von Obst und Gemüse und zum Ausgleich für einen engen, zubetonierten Hinterhof. Den zweiten Schrebergarten erbte Michael kurz darauf von seinen Eltern. Er lag am anderen Ende der Stadt und war für ihn voller Kindheitserinnerungen, die er nicht verlieren wollte. Dass der dritte Schrebergarten frei stand, erfuhr er über Bekannte, die ihren eigenen Garten nebenan hatten. Die Pacht des Grundstücks war gering und Michael bekam alles darauf stehende geschenkt. Als wir ihn dort das erste Mal besuchten, wurde uns schnell klar, warum: Das Haus hatte nicht nur jahrelang leergestanden, es war schlagartig mit allem, was außerhalb und innerhalb von ihm herumlag verlassen worden, so als wären die Besitzer nicht eines natürlichen Todes gestorben.
Es war ein lauer Spätsommernachmittag und unsere Kinder verschwanden sofort mit Michaels Kindern im Dickicht der wildwuchernden Pflanzenwelt. (Michaels Frau wollte später nachkommen, sie schrieb an ihrer Dissertation. In Wahrheit aber nervte sie Michaels Tick ein bisschen.) Michael führte uns stolz über das Gelände und gestand uns, dass er noch längst nicht alles entdeckt hatte, was hier schlummerte. Er hatte in einer Ecke bereits angefangen, sich landschaftgärtnerisch zu betätigen und auch für das verfallene Haus hatte er weitreichende Pläne.
Es gab allerdings weder Wasser noch Strom, was sein Vorhaben in den Bereich des Abenteuers rückte. Seine Augen leuchteten und mir fiel es wie Schuppen von den Augen, warum er in all diese Gärten vernarrt war: Michael, von Beruf Architekt, verkümmerte in irgendeinem Amt für Gebäudesicherheit – die Schrebergärten waren das Terrain, auf dem er sich ungezügelt ausleben konnte.
Wir vergaßen ganz die Zeit und es begann zu dämmern. Die Kinder kamen mit rostigen Sägen, Äxten und Messern an, die sie in einem von Spinnen durchwebten Schuppen gefunden hatten und die wir erstmal sicher stellten, ferner mit einem wie neu glänzendem Geschirr und verstaubten Kerzen. Michael hatte das letzte Mal einen alten Steingrill hinterm Haus entdeckt und packte nun Kartoffeln, Olivenöl, Kohle und Zündhölzer aus, um Pommes herzustellen. Eigentlich hatten wir nicht geplant, zum Abendessen zu bleiben, aber ein Abend am Lagerfeuer — das konnten wir den Kinder doch nicht vorenthalten.
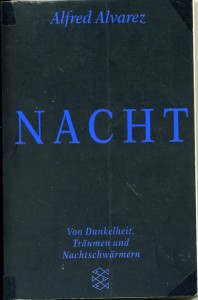 »Wisst ihr, wie dunkel die Nacht gewesen ist, bevor es Kerzen oder Öllampen gab?«, begann ich zu erzählen, während die Männer Feuer machten und Kartoffeln schälten. »Und womit die Menschen sich Licht gemacht haben?« — »Sie zündeten getrocknete, ölige Fische oder Vögel an, die sie auf Pfähle steckten.«
»Wisst ihr, wie dunkel die Nacht gewesen ist, bevor es Kerzen oder Öllampen gab?«, begann ich zu erzählen, während die Männer Feuer machten und Kartoffeln schälten. »Und womit die Menschen sich Licht gemacht haben?« — »Sie zündeten getrocknete, ölige Fische oder Vögel an, die sie auf Pfähle steckten.«
Im flackernden Licht des kleinen Feuers, sah ich den Unglauben auf den Gesichtern meiner Zuhörer, aber auch, dass sie sich vorzustellen suchten, wie das wohl ausgesehen und gerochen haben mochte.
Mein Wissen über die erste Straßenbeleuchtung, über Sperrstunden und Talgkerzenzieher bezog ich aus der Lektüre der faszinierenden Buches »Nacht« von Alfred Alvarez, die ich erst vor wenigen Tagen abgeschlossen hatte — mit Wehmut, wie das immer so ist, wenn ein Buch nicht nur interessant ist, sondern auch durch eine tiefere Schönheit und Wahrheit berührt.
Alvarez, 1929 in London geboren, ist Essayist, Lyriker und Literaturkritiker. Nacht hat er mit all diesen drei Begabungen geschrieben. Es ist eine über 300 Seiten umfassende Reise, die mit der Fähigkeiten des Menschen, die Nacht zu illuminieren, beginnt, und über die Kellergewölbe aus Alvarezs Kindheit, die Ängste seiner Mutter, die Austauschbarkeit von Nachtwächtern und Dieben, Bomberangriffe auf London, den Zusammenhang von Sexualität und Geschichtenerzählen, die Sucht zu Essen, Edisons Abneigung gegen den Schlaf, die Erfindung der Nähmaschine, die Bedeutung von Nacht und Traum in den verschiedenen Kunst-Epochen, die hohen Wände eines Schlaflabors und eine Polizeistreife in NY – in die Stille einer italienische Nacht mündet.
In diesem gut recherchierten und scharfsinnig kombinierten Text gibt es so vieles zu entdecken und nachzudenken. Die Nacht wird dadurch nicht heller sondern größer, und in einer Zeit, in der es kaum noch dunkel ist, tut das ungemein gut. Am Ende der Lektüre erscheint eher der Tag unheimlich, der mit einem unmenschlichen Aufwand an Energie, das Dunkel zu kontrollieren versucht.
»Aber es gibt noch große Flächen von Dunkelheit da draußen, Nacht, so wie sie in dieser Gegend immer war, und die schwärzeste Masse ist der dem Haus gegenüberliegende Bergrücken. (…) Bei Tag ist der Berg still und dräuend; bei Nacht ist er ein massives Stück Dunkelheit, eine Nacht innerhalb der Nacht, im unmittelbaren, realen Sinn. Er lässt alle Illuminationsversuche sowohl aufdringlich als auch erbärmlich erscheinen; also lassen die Hausbewohner aus Achtung vor ihm und der Nacht und den Mücken die Außenbeleuchtung des Hauses ausgeschaltet, wenn sie das Abendessen draußen einnehmen, und essen bei Kerzenlicht.«

