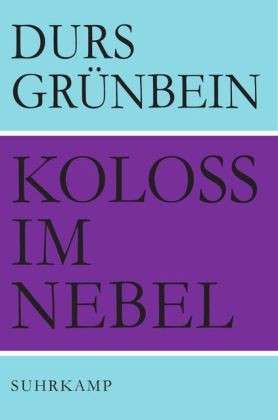 Was ist nur bei Durs Grünbein schief gegangen? fragt Fritz J. Raddatz in der WELT: Er wird ausgerufen zu einer »der markantesten Stimmen deutscher Dichtung unserer Zeit«. Vollmundiger PR-Unsinn. Wie schon seit langem und an diversen Publikationen zu beobachten: Grünbein gelingen gelegentlich recht beachtliche Gedichte – ein stringentes poetisches Werk gelingt ihm nicht. Das zeigt der neue Gedichtband auf geradezu erschreckende Weise. Es sind Verse ohne Rätsel, ohne Geheimnis, ohne Erschütterung für den Leser. Plauderpoeme mal schnoddrig, mal pseudotiefsinnig, mal bildungstouristisch. Sie sind so rasch ›abgreifbar‹ – will sagen: begreifbar – wie Fernsehnachrichten. Auch zuchtlos. Große Lyrik aber umschließt gleich einer Frucht ihren Kern einen fast sakralen Innenraum, ein Unberührbares, Unauflösliches.
Was ist nur bei Durs Grünbein schief gegangen? fragt Fritz J. Raddatz in der WELT: Er wird ausgerufen zu einer »der markantesten Stimmen deutscher Dichtung unserer Zeit«. Vollmundiger PR-Unsinn. Wie schon seit langem und an diversen Publikationen zu beobachten: Grünbein gelingen gelegentlich recht beachtliche Gedichte – ein stringentes poetisches Werk gelingt ihm nicht. Das zeigt der neue Gedichtband auf geradezu erschreckende Weise. Es sind Verse ohne Rätsel, ohne Geheimnis, ohne Erschütterung für den Leser. Plauderpoeme mal schnoddrig, mal pseudotiefsinnig, mal bildungstouristisch. Sie sind so rasch ›abgreifbar‹ – will sagen: begreifbar – wie Fernsehnachrichten. Auch zuchtlos. Große Lyrik aber umschließt gleich einer Frucht ihren Kern einen fast sakralen Innenraum, ein Unberührbares, Unauflösliches.
Was für Durs Grünbein gilt, trifft auch zu auf Nora Gomringer, sie ist die Allert-Wybranietz der Postmoderne, die sich gern als Slammerin tarnt; Gomringer schreibt Befindlichkeitslyrik, die sich um den eigenen Bauchnabel kräuselt. Dies Dame produziert unendliche Langeweile, gelehrsame Selbstverliebtheit und melancholische Gesinnungslyrik. Es fehlt der Tochter von Eugen Gomringer insbesondere an Überraschungsmomenten, an individuellem Ausdruck, es ist kaum mehr als veredeltes Gekritzel. Darin gleicht sie dem, was sich auch sonst im Netz tummelt. In ihren Facebook-Beiträgen stellt sich eine junge Lyrikgeneration als Neurotiker, Leidende dar, die ihr Heil im Narzissmus suchen. Die überbordende Sprachgewalt – beispielsweise eines Thomas Kling – ist fachsprachlichem Jargon gewichen, das Pathos wird in den Modus der analytischen Beschreibung transferiert. Diese Generation prahlt pfauenhaft mit ihrer handwerklichen Meisterschaft, sie produziert eine Lyrik, die sich als bessere Coffee-table-Lektüre eignet.