„Es wird leer um mich herum“, schreibt Peer Kehlenbach, der Ich-Erzähler, und fügt hinzu: „Ich, der gescheiterte Autor.“ (S. 5) Zu seinem Freund und Verleger Pretenius sagt er am Telefon: „Ich versuche zu überleben …“ (S. 7), aber „… ich hab einfach kein Thema.“ (S. 10)
Doch, er hat ein Thema. Er hat mehrere Themen. Das ist es ja auch, was die Novelle auszeichnet: Wie die Themen wie aus dem Nichts erzeugt und miteinander verstrickt werden. Was heißt: aus dem Nichts?
Peer, der Mittvierziger, wird von seiner Frau verlassen. Nun steht er allein da, wie erschlagen. Er sucht nach Gründen, findet nicht viel außer: Er konnte nicht mithalten, er bot Anna nur die Aura des Dichters, mit der sie sich schmücken konnte, aber dann fehlte der Erfolg, der Durchbruch. Anna lässt ihn fallen, die Ehe dauerte offenbar nur so lange, wie Annas narzisstische Schwärmerei für einen vorzeigbaren Dichter dauerte.
In Karlhanns Pretenius hat Peer dagegen einen Freund, der an ihn glaubt und ihm hilft, das schwer auf Peer lastende Trauma zu überwinden. Er bringt den Freund in einem Moorhaus unter, wo er wieder zu sich und der Lyrik finden soll.
Diese Versuchsanordnung funktioniert nach anfänglichem Leerlauf immer besser – und sie funktioniert eben auch nicht. Die Art, wie Marcus Neuert diesen komplizierten Prozess der Trauerarbeit und Selbstfindung seines Helden darstellt, ist höchst subtil und führt auf einen Weg, der sich am Ende gabelt; der eine Weg führt ins Licht, der andere ins Dunkel. Aber davon nachher mehr.
Zunächst verliert sich Peer in seiner Trauer, die Verdrängung des Verlusts gelingt nicht. Peer Kehlenbach macht seinem Namen alle Ehre, nicht nur abends fließt der Wein durch seine Kehle. So kommt er nicht zum Schreiben.
Da findet er unter losen Dielen ein Bündel Briefe, die er zögernd liest: Dort entfaltet sich vor ihm die Geschichte zweier Liebender in den 50er Jahren, eine verbotene Liebe, ein Mittvierziger, Familienvater, Ministerialdirigent in Hannover, Niels Linnenhaupt, der liebt ein Schulmädchen, das vor dem Abitur steht, sie heißt Magda und wird ihm hörig. Aber die Liebe muss geheim bleiben, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse sie nicht zulassen, aber auch, weil er das ihm total ergebene Gretchen nur für sein männliches Ego ausbeutet, ohne seine berufliche Stellung und Ehe gefährden zu wollen, das ist eine alte Geschichte, sie passiert immer wieder.
Gleichzeitig hat Peer seltsame Gesichte, wenn er am Moorsee spazieren geht. Ihm kommt es so vor, als sehe er am Ufer eine Gestalt, er kann sie nicht erkennen, aber er bringt sie mit den Briefen in Verbindung … und irgendwie haben die Briefe, die Gestalt, der Moorsee mit ihm zu tun, er weiß nicht, was. Und Nacht für Nacht erlebt er – als wäre es leibhaftige Wirklichkeit – Szenen mit einer Frau, die erst verschleiert ist, sich ihm dann als Magda offenbart und hingibt.
Pretenius besucht Peer, der eine gewisse Kontrolle braucht, ab und an. Er ist sein einziger Halt. Pretenius ist sowieso immer da, er ist das in Peer präsente Über-Ich, sein alter ego, er nennt es den kleinen Pretenius, der ständig seine überzogenen Gedanken und Vorstellungen relativiert.
Angeregt durch die Briefe und Erscheinungen am Moor schreibt Peer Gedichte, die Pretenius unverhofft reif und groß vorkommen.
Auch der Leser glaubt nun, Peer gelingt die Trauerarbeit und Selbstfindung, indem er sein Seelendrama in allgemeingültige Gedichte transformiert. Die nächtlichen Träume wirken wie Bilder seiner Sehnsucht nach neuer Liebe. Offenbar ist Peer auf dem besten Weg der Gesundung, ja, das Trauma des Verlassenwerdens scheint ihm sogar zum dichterischen Durchbruch verholfen zu haben.
Unterstützt wird diese Annahme durch die feine Ironie des Ich-Erzählers, der sich selbst sehr genau beobachtet; besonders die literarischen Anspielungen zeigen das, etwa wenn Peer schreibt: „Meine Ruh ist hin …“ (S. 31), denn sein Herz ist schwer, oder wenn er am See steht, da fällt mir Goethes Ballade vom Fischer ein, nur dass Peer in anderer Weise angezogen wird vom See und anders hinsinkt als der Fischer, denn Peers Nixe ist keine leibhaftige Frau, sondern eine vertrackte Selbstverführung im eigenen Kopf. Die Empathie und Identifizierung mit Magda wird immer stärker und nimmt schließlich pathologische Züge an – wenn er etwa glaubt, „Magda … beginnt dreidimensional zu werden.“ (S. 33) Er hört sie nachts sprechen: Komm! Er soll sie retten …
Während Pretenius Peers Gedichte liest, hackt dieser Holz: „Mein Schädel scheint auf den Haublock gelegt zu sein. Kopf ab und Schluss, das wäre auch eine Alternative. Aber man kann sich nicht enthaupten, zumindest nicht in dieser Versuchsanordnung.“ (S. 60) Das ist doppelt ironisch: Pretenius kann seine Gedichte zerhauen – und andererseits ist das eine sanfte Anspielung auf eine denkbare Selbsthinrichtung. Diese aber wird immer unwahrscheinlicher, denkt der Leser, denn die Gedichte sind gut, und die nächtlichen Erscheinungen werden schwächer. Denn Magda sagt ihm: „Ich habe meinen Frieden gefunden bei dir …“ (S. 74)
Diese nächtlichen Szenen – in denen ein anderer Erzähler auftritt, der in der dritten Person berichtet, wo Peer wie eine Kamera über sich selbst schwebt und sich beobachtet wie in Sterbevisionen – bilden eine zweite Erzählebene, die Briefe Magdas an Niels eine dritte. Sie stehen miteinander in einem dialektischen Verhältnis. Die Nachtszenen und Briefe spiegeln Peers Seelendrama.
Peer erkennt immer mehr: Seine Wahrheit findet er nicht in den Briefen, sondern nur in sich selbst. In den Gedichten findet er sich!, denkt der Leser. Ja, Lyrik macht bewusst, und das erkennt Peer (S. 76):
„Das Gedicht … lotet aus, erforscht jeden Winkel. Aber es wünscht nichts und vor allem: es heilt nichts, im Gegenteil. Je besser es gemacht ist, desto tiefer stößt es dich hinein in Leid oder Genuss, ins Irrationale. Vielleicht ins Vermeidbare. Vielleicht auch ins Schicksal, wer weiß das schon so genau. … Meine Gedichte werden meine Zeit mit Magda. Meine Zeit mit Magda wird Gedicht. Und ich spüre, nein: ich weiß, dass es mich künstlerisch voranbringen wird. Aber dieser Vorgang hat einen hohen Preis, ich bezahle mit der schrittweisen Aufgabe dessen, was man oberflächlich als Realität bezeichnen könnte.“ (S. 76)
Peer sieht auch die Gefahr: „… immer öfter schwimmen mir Lyrik und Liebe, Alltag und Traum ineinander, und instinktiv ahne ich, dass dies kein Dauer-zustand werden darf – irgendwann wird der Punkt überschritten sein …“ (S. 78)
Lyrik kann, wie der Traum, schützender Kokon sein, um der Realität nicht ausgeliefert zu sein, sie kann auch – und diesen Weg geht Peer leider nicht zu Ende – zu Erkenntnissen führen und neue Realität eröffnen, wenn die Wunden der Vergangenheit akzeptiert werden.
So ist Marcus Neuerts Erzählung auch eine Geschichte über das Wechselspiel von Leben und Dichtung, Dichtung und Wahrheit. Die Unerhörtheit der Novelle zeigt sich in den phantastisch-romantischen Nachtstücken, die in Peers Leben hinein wuchern, bis er ohnmächtig wird und – genau im Moment möglicher Überwindung! – untergeht. Die Bilder seines Seelentheaters und Genesungsprozesses, die Freundschaft Pretenius’ und die Traumarbeit der Nachtszenen, versagen am Ende.
Zwar hat sich Peer aus dem Weinkeller-Leben immerhin hinauf gearbeitet in die Küche, er weint sogar, aber auch diese kleine Katharsis rettet ihn nicht. Im 12. und vorletzten Kapitel überfällt ihn wieder ein Alptraum, seine neue Droge, diesmal aber nicht nachts, sondern am helllichten, wenn auch trüben Tag, und er wird dabei real Handelnder. In übermächtiger Identifikation mit Magda, eine Verschmelzung von Fausts Gretchen und Maria Magdalena, versinkt er nolens volens im Moor des Seeufers, als sühne er für alles, was der feige Liebhaber Magda angetan hatte, die in Peers Wahnvorstellung mit dem leblosen Bild ihres Geliebten in den See ging. Und dies ist das eigentlich unerhörte Ereignis.
Hier hätte die Novelle enden können. Ob Peer wirklich im Moor versank, oder ob auch dies nur als Bild zu verstehen ist, hätte offen bleiben können.
Aber es folgt ein letztes Kapitel, in dem Petrenius zum (nunmehr dritten) Erzähler wird und der Geschichte noch ein gewagtes Surplus aufsetzt, indem Peers Phantasterei ins Reich des Pathologischen verbannt wird. Nur seine Gedichte als Ergebnis eines allgemeingültigen Erkenntnisprozesses überleben, Petrenius wird sie veröffentlichen. Darin kann der Leser doppelte Ironie sehen: Solche Gedichte gibt es nicht. Die Wirklichkeit ist viel zu komplex, als dass sie begriffen werden könnte. Und ich denke an Peers Seele, der im Leben ihr göttlich Recht | Nicht ward, sie ruht auch drunten im Moorkus nicht; | Doch ist ihm das Heilige, das am | Herzen ihm lag, das Gedicht, gelungen. | Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Alles in allem: Eine subtile, ernste wie heiter-ironische, sprachlich und strukturell brillant erzählte, spannende Erzählung!
***
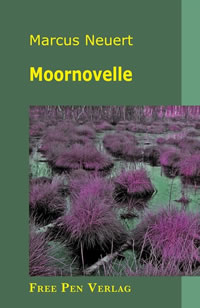 Moornovelle von Marcus Neuert. Free Pen Verlag, Bonn 2012.
Moornovelle von Marcus Neuert. Free Pen Verlag, Bonn 2012.