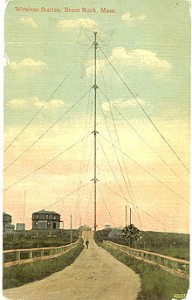Vor den Soaps im Fernsehen gab es die Soaps im Radio. Es waren Familienserien „Pension Spreewitz“ aus Westberlin, „Neumann 2 x klingeln“ in der DDR und in Österreich gab es „Die Radiofamilie Floriani“. Die beiden erstgenannten konnte man vor nicht allzu langer Zeit im Sender Deutschlandradio Kultur in origineller Form wieder hören. Je eine Folge der Ost- und eine der Westserie wurden gekoppelt und leicht ironisch aus heutiger Sicht kommentiert.
Vor den Soaps im Fernsehen gab es die Soaps im Radio. Es waren Familienserien „Pension Spreewitz“ aus Westberlin, „Neumann 2 x klingeln“ in der DDR und in Österreich gab es „Die Radiofamilie Floriani“. Die beiden erstgenannten konnte man vor nicht allzu langer Zeit im Sender Deutschlandradio Kultur in origineller Form wieder hören. Je eine Folge der Ost- und eine der Westserie wurden gekoppelt und leicht ironisch aus heutiger Sicht kommentiert.
Die Florianis dagegen sind nun als Buch bei keinem geringeren als beim Verlag Suhrkamp erschienen. Nicht alle 330 Folgen, sondern die 15, die Ingeborg Bachmann geschrieben hat. Ja – Ingeborg Bachmann hat Soaps verfasst. Genau in der Zeit, als sie kometenhaft am deutschen Literaturhimmel erscheint. Kein Wunder also, dass sie selbst nirgendwo die Soaps erwähnt.
Möglicherweise gibt es sogar diese Selbstzeugnisse, aber der private Nachlass Ingeborg Bachmanns ist bis zum Jahr 2025 gesperrt. Das ist noch eine Weile hin, und damit wir bis dahin die Bachmann nicht vergessen, dürfen wir nun ihre Soaps lesen. Ich musste das tun, weil ich mich für diese Rezension entschieden hatte. Ganz ehrlich: ich bin dauernd eingeschlafen.
Da ist eine bürgerliche Wiener Familie: Vater Hans ist der biedere Oberlandesgerichtsrat, der sich hin und wieder heimlich einen Wermut-Soda im Kaffeehaus genehmigt und seine Kinder mit Angeklagten verwechselt. Mutter Vilma ist die grundgütige Hausfrau, hat immerhin irgendwann einmal zwei Semester Kunstgeschichte studiert und die beiden Kinder Helli und Wolferl sind 17 und 13 Jahre alt und zoffen sich untereinander oder mit ihren Eltern. Da ist der Bruder von Hans, Guido, der Bewegung in die Familie bringt, weil er abstruse Dinge erfindet oder sich für einen Habsburger hält. Die Alten verdrehen die Augen und leihen ihm immer mal Geld, die Kinder finden ihren Onkel toll.
Den Wienern bereitete diese Familienserie großes Vergnügen, auch, weil auf humorvolle Weise Diskussionen der Zeit verarbeitet wurden, wie die gemeinsame Erziehung von Mädchen und Jungen in einer Klasse. Geliebt wurde die Serie vor allem deshalb, weil deren Darsteller bekannte Wiener Schauspieler waren. Darauf weist auch die Wahl der Namen hin; die Figuren sind nach den Vornamen der Sprecher benannt.
Aber was sollen wir heute mit diesen kleinen Streitereien anfangen. Wir fragen uns, wo waren die Florianis im Krieg? Die Kinder sind Jahrgang 1935 und 37, haben also den Krieg auch erlebt. Die ganze Familie hat keine Vergangenheit. Einzig dem Onkel Guido wird ein Mitläufertum nachgesagt, er war ein „kleiner Nazi“. Und aus dem kleinen Nazi ist dann ein komischer Vogel geworden? Und das soll sich Ingeborg Bachmann ausgedacht haben?
Spätestens jetzt muss der Mann genannt werden, dem wir dieses Vergnügen verdanken: Joseph McVeigh ist Historiker und Germanist, Professor am Smith College in Northampton, er erforscht vor allem deutsche und österreichische Nachkriegsliteratur. Er hat diese 15 Folgen der Radiofamilie herausgegeben und ein ausführliches anmerkungsreiches Nachwort verfasst. Anlass war, dass in den 1990er Jahren im Nachlass von Jörg Mauthe, Kollege und Mitverfasser der „Radiofamilie“, Typoskripte auftauchten, die eindeutig Ingeborg Bachmann zugeordnet werden konnten.
Den Radiosendern kommt in der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle zu. Die Besetzer nutzen sie zur Umerziehung und Demokratisierung der Deutschen, aber auch der „Mitläufer“ in Österreich. In Wien gibt es einen russischen Sender und der amerikanische Sender „Rot Weiß Rot“ setzt bewusst gegen die kommunistische Ideologie bürgerliche, konservative, demokratische Werte. Es soll an den Vorkriegsstatus Österreichs angeknüpft werden. Bei diesem Sender nun arbeitet Ingeborg Bachmann, nachdem sie 1950 in Wien über Heidegger promoviert hat. Zuerst als Sekretärin, dann als Skript Writer. Es ist ein gut bezahlter Job. Sie übersetzt, sie bearbeitet beispielsweise Franz Werfels Novelle „Tod des Kleinbürgers und Thomas Wolfes Drama „Mannerhouse“. Sie schreibt das Hörspiel „Ein Geschäft mit Träumen“, das 1952 gesendet wird. Neben ihrer Arbeit beim Funk schließt sie einen ersten Roman ab, der als verschollen gilt und schreibt Buchrezensionen, ein Essay über Musil und natürlich – Gedichte. Für die später unter Schreibblockaden leidende Bachmann sind diese frühen 1950er Jahre die schaffensreichste Zeit. Ein halbes Jahr nach Beginn ihrer Tätigkeit beim Sender wird sie von der Gruppe 47 eingeladen, ein Jahr danach erhält sie den Preis der Gruppe 47, wenige Wochen bevor ihr erster Gedichtband „Die gestundete Zeit“ erscheint, direkt danach verlässt sie den Sender und wird freiberufliche Schriftstellerin. Mit anderen Worten: Ingeborg Bachmann arbeitet in dieser Zeit konsequent und stringent an ihrer Schriftstellerkarriere. Die Redakteurstätigkeit ist ein Brotjob. Und die „Radiofamilie“ steckt in dem engen Korsett der Serie, die ideologischen Vorgaben kamen von den Amerikanern. Ob Bachmann an der Konzeption der Serie mitgearbeitet hat, ist noch nicht zu Ende erforscht. Und selbst wenn … Das ist Handwerk, das sich die Skript Writer anhand einiger amerikanischer Handbücher selbst beigebracht haben.
Doch McVeigh sieht in der Seifenoper mehr. Er sucht eine Verbindung vom Stil der „Radiofamilie“ zu Bachmanns späterem Schaffen. Er nennt drei Aspekte: die positive Beschäftigung mit dem bürgerlichen Alltag, die Figur des Nazi-Mitläufers Guido und insgesamt den humorvollen Ton. Letzteres griff das deutsche Feuilleton in der Besprechung der „Radiofamilie“ jubelnd auf: endlich eine humorvolle Bachmann, war da so oder ähnlich zu lesen. Man könnte McVeigh erwidern: Dass die Serie in einem altbackenen Wiener Humor gehalten ist, den auch Skript Writer Bachmann bedienen muss, gehört wohl zum Handwerk. Und dass Humor in ihren literarischen Werken nicht vorkommt, könnte auf diese Erfahrung zurück zu führen sein, dann wäre es eine Abgrenzung.
 Mc Veighs andere Behauptungen sind noch merkwürdiger: So sieht er in der Figur des liebenswerten Spinners Guido eine Rehabilitation des beschädigten Vaterbildes der Bachmann und eine Vorwegnahme der Vaterfigur in „Malina“. Und schließlich: der bürgerliche Alltag sei das, wonach die Bachmann sich gesehnt hätte. Er stellt die These auf: „Die Dichterin (…) bedient sich der relativen Anonymität des Mediums Radio, um auf diskrete Weise auch persönliche Dämonen zu bannen.“ Die Veröffentlichung der „Radiofamilie“ sei ein erster Schritt (Achtung, da kommen also noch mehr!) zu einem „neuen Verständnis der Dichterin“ und ihrer Werke in den frühen 50er Jahren.
Mc Veighs andere Behauptungen sind noch merkwürdiger: So sieht er in der Figur des liebenswerten Spinners Guido eine Rehabilitation des beschädigten Vaterbildes der Bachmann und eine Vorwegnahme der Vaterfigur in „Malina“. Und schließlich: der bürgerliche Alltag sei das, wonach die Bachmann sich gesehnt hätte. Er stellt die These auf: „Die Dichterin (…) bedient sich der relativen Anonymität des Mediums Radio, um auf diskrete Weise auch persönliche Dämonen zu bannen.“ Die Veröffentlichung der „Radiofamilie“ sei ein erster Schritt (Achtung, da kommen also noch mehr!) zu einem „neuen Verständnis der Dichterin“ und ihrer Werke in den frühen 50er Jahren.
Gar nicht zu lesen ist bei McVeigh, dass der Rundfunk für die meisten Nachkriegsschriftsteller eine wichtige Einnahmequelle war. Viele Schriftsteller der Gruppe 47 arbeiteten für den Funk. Vieles von dem, was damals für den Funk geschrieben wurde, ist heute vergessen. Gebleiben sind die literarischen Formen des Funks: Essay (Arno Schmidt) und vor allem das Hörspiel (Böll, Hildesheimer, Lenz, Eich, Aichinger), das in den 1950er Jahren eine heute unvorstellbare Blütezeit erlebte, die Quote betrug Abend für Abend 30 bis 40 Prozent Zuhörer! Der hochangesehene Hörspielpreis der Kriegsblinden war ein Ritterschlag, den Ingeborg Bachmann 1959 mit dem Hörspiel „Der gute Gott von Manhattan“ empfing. Ein Teil ihres ‚gültigen‘ Werkes entstand für den Funk. Die „Radiofamilie“ allerdings hat Ingeborg Bachmann aus gutem Grund verschwiegen und dabei hätte man es belassen sollen.
* * *
Ingeborg Bachmann: Die Radiofamilie, herausgegeben von Joseph McVeigh, gebunden, 411 Seiten, 24,90 Euro, ISBN: 978-3-518-42215-1 Suhrkamp Berlin 2011
Wir danken Julietta Fix für die Cooperation.