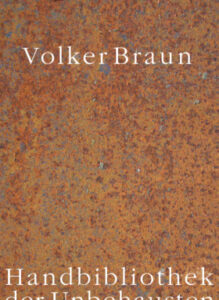Volker Braun, das Wunder dieses Dichters ist ein erschütterndes und beglückendes zugleich. Der Büchnerpreisträger, einer der, wie sich herausstellen durfte, Würdigsten solcherart Geehrten der letzten und vorletzten Dekaden (Hilbig winkt aus der mittleren Ferne, die Kirsch schwirrt anbei), offeriert mit seinen neuen Gedichten eine fortgesetzte Übung in Beständigkeit, wacher Bissigkeit, wie sie auf den flegräischen Rieselfeldern – wohl aus einem vervielfältigten Missverständnis – dieser intimsten Dichtart selten geworden ist.
Ja, denn allen Frohlockungen zum Trotz tummelt sich in ihr auch jede Menge Tand. Braun indes ist selbst, wenn es ihn in die weit gestreute Ferne zwischen Berlin, China und dem Mansfeld treibt, ein Meister des sezierenden Blicks: manch Ätzkalk mischt sich unter die Fahrtenbücherverse, selbst das Leichte ist nicht leicht, es ist wohlgesetzt, bezieht seine Schwebe aus dem Unbehagen einer in die Quere ihrer selbst wieder und wieder geratenden Epoche. Tand, Tinnef, die um des Effets gesetzte Nichtigkeit sucht man in diesen Texten, auch wenn sie sich zwischenher durchaus einer leichteren (inneren) Tönung bedienen, vergeblich.
Es ist: die Welt an sich wie Mittelgermanien, jener vergessene Landstrich der Geschichte, es sind die Reisen zu den großen Orten, wo die Blicke des Unbehausten zwischen Flüssen und Pyramiden aufgespannt sind; und der Mensch, dessen Glanz und Abgründe in eins gehen und den Aufgeklärten zweifeln, das Gebiss mahlen und verzweifeln lassen. Geföhnte Gorillas, die mit Sprengköpfen oder Geldrollen spielen, es ist sich scheinbar gleich im Neu-Jahrhundert der Kopf-Abschläger, der Panzerweg-Schleifer: was dem einen sein Schwert, ist dem andern seine Quelle. Dazwischen strikte Verse von zarter Biegsamkeit und dieses grandiose „Wilderness“, das einem die Frisur sausen lässt bis tief in die Papillen des Hirns.
Braun, der Dialektiker. Ein hoffender Zweifler, dem es um die Menschen und Dinge zu tun ist, deren Verlorenheit er nur schwer, unter Enttäuschung und Protest, hinnehmen mag. Braun, dessen Analysen zugleich immer persönliches, persönlichstes Terrain berühren, er gibt nicht auf, und sei es, dass seine Heiterkeit eine schwarzgeränderte ist. Das ist sie. „Jetzt gehts ans Konto, an das Eingemachte. / Ich krieg die Krise, weil der Weltkreis krachte. Wo ist nun unser Mut? das Aufbegehren?“ – in diesem bissigen Schlussstück einer sich über nahezu drei Jahrzehnte ziehenden Gedichttrilogie wandelt sich die Weltlage in den Irrwitz, wie wir ihn noch erleben, einen „Witz“, der sich von „unsrer Schwachheit“ nähren soll.
Und es endet wie befürchtet: „Was sind wir noch zum Schein, was sind wir schon? / Ein Bettelvolk. Ich sags auch mir zum Hohn.“ Kleine Zeiten, die große nachahmen wollen, führen zu kleinlichen, buchhalterischen und dennoch vor Unterkühltheit umso durchgeknallteren Umständen. Was bleibt, ist reisen, vielleicht, und sich dem Wunsch hinzugeben, dass bessere dergleichen kommen. Indes, noch rollen die Panzer, verbal wie metallen.
Ein Denk-, ein Hinschau-Ort ist diese Braunsche Bibliothek, und ein Trost-Ort ist sie für diejenigen, deren Gedankengebäude nicht an den Klippen des Konsum- und Gesinnungsterrors abstürzt und fortan blödhälsig, mit schlappender Zunge der jeweiligen Siegersprache nachhechelt im spätfeilen Ertrinken. Naja, als ob es nicht immer so gewesen wäre – man weiß es nicht, aber angesichts von 300 Jahren wüst bekämpfter Aufklärung ist es erschütternd, was das begnadete Wesen doch nicht mehr zu lernen vermag.
Ist es der Schimpanse in uns, ohne dem Tier Unrecht tun zu wollen? Oder die ermüdete Spielform unserer Neotenie? Grausam mag es auf jeden Fall sein, das ist sicher, ein ausgedehntes Leidgebiet für die Denkenden. Von den Empfindenden kaum zu sprechen. Womöglich ist auch deshalb bereits ein Diminutiv eingebaut – von einer Handbibliothek wird bereits gesprochen: damit man sie im Ernst schnell verbergen kann? Ist es schon soweit. Wer hätte, außer Braun und einer Gruppe eben unbehauster Nutzer, gedacht, wie fix (im doppelten Sinne) der Unschlitt, der unsere Jahre begleitet, so schnell und unwidersprochen salonfähig würde? Die saumseligen Befürworter einer Hoch-Sprache, die nachlässig wird? Die Bejubler des Fortschritts, der zur Falle wurde? Die erpichten Weltumsegler, mit beiden Händen an ihre individuelle Story gepiekt und geschlossenen Augs eben jene er- und verklärend?
Dieses in grimmiger Weitsicht, ja, in rußender Heiterkeit geschriebene Buch, es gehört zugleich zu den bedeutendsten Gedichtbüchern des jungen und doch schon so schön bedröppelt aus der Wäsche guckenden Jahrhunderts. Wohl dem – diese „Handbibliothek der Unbehausten“, und bereits der Titel lässt die Augen und den Solarplexus schlackern, ist eine reife Übung in „Wilderness“ geworden. Es mögen diese Gedichte sein, die die Sabbler in ihren falben Godzilla-Träumen jagen. Es ist noch nicht zu Ende. Eindeutig. Wohl dem.
***
Weiterfühend →
Poesie ist das identitätsstiftende Element der Kultur, KUNOs poetologische Positionsbestimmung.