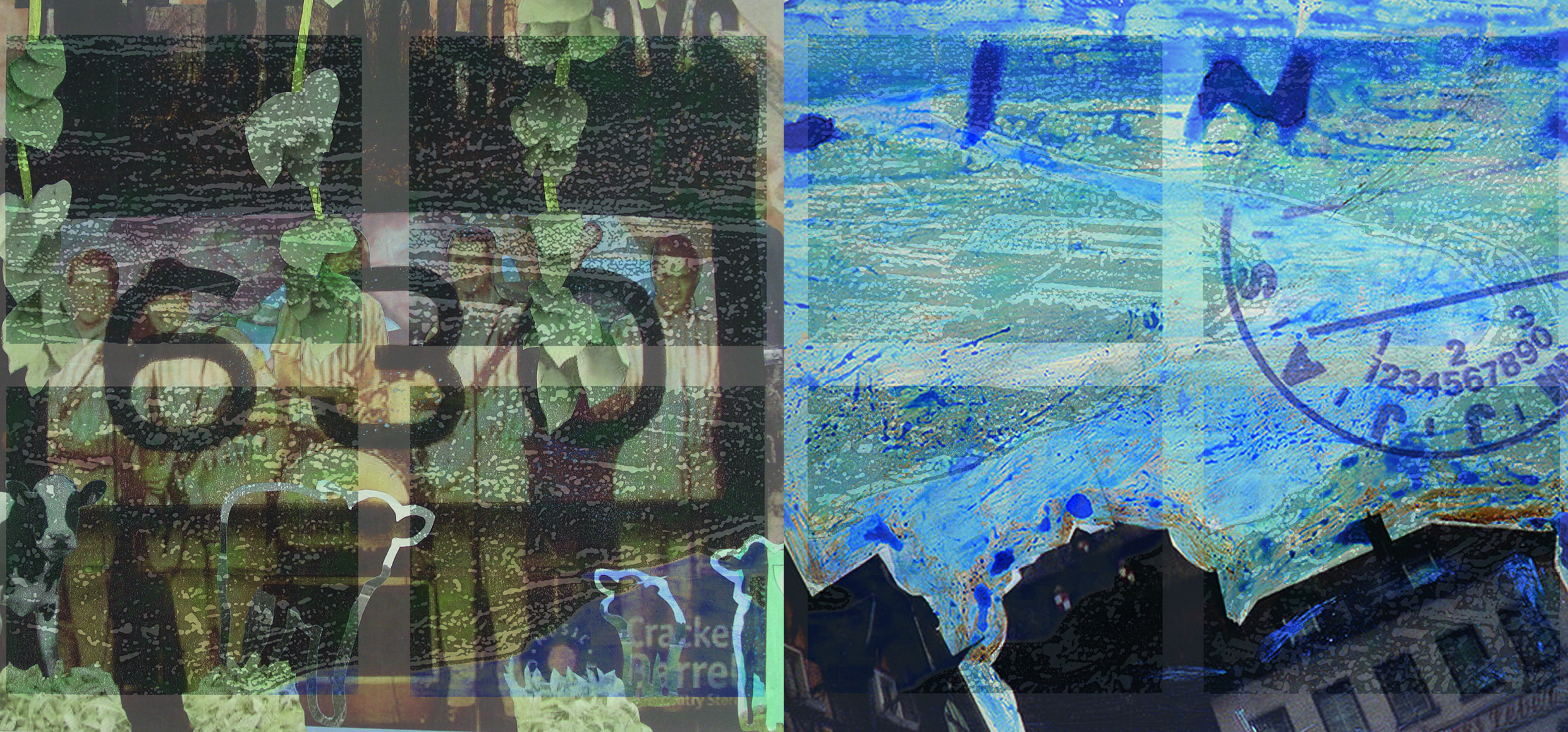Romane enthalten keine Argumente, was sollte es für einen Sinn haben, mit Autoren über sie zu diskutieren?
Jürgen Kaube
A.J. Weigoni erzeugt über seine Bücher hinaus keinerlei Lärm. Er tritt nicht mehr bei Lesungen auf, gibt kaum Interviews, schreibt keine Meinungsartikel für Zeitungen, mischt sich nicht ins Debattengeschäft ein. Warum auch? – Meine Beziehung zu Weigoni wird durch die geheime Abmachung geprägt, sich nie zu nahe zu treten; dahinter steht ein Selbstverständnis, das Heinrich von Kleist folgendermaßen ausgedrückt habe: „Ich weiß nicht, was ich Dir über mich unaussprechlichen Menschen sagen soll“. Die einzige Möglichkeit mit ihm ein Hintergrundgespräch zu machen ist die E-Mail. Weigoni hat die Gabe, über seine eigenen Arbeiten gelassen und selbstbewusst zu sprechen: ohne sie zu überhöhen, ohne sie zu interpretieren und ohne irgendetwas an ihnen zu relativieren oder zurückzunehmen.
Wörtschel: Woran denkst du beim Wort Literatur-Betrieb?
Weigoni: An Ware und Verkauf, an ein schwer einzuschätzendes System, das von Moden geprägt wird. Wir benötigen Poesie nicht in dem Sinne, nutzlos ist sie deswegen nicht, sie bereichert das Leben und lässt uns nachdenken.
Wörtschel: Du beschäftigst dich zeitlebens mit Trivialmythen, welchen Einfluss hat das auf deine Arbeit?
Weigoni: Die Anlässe sind meist banal. Das geht von einer Zeitungsnotiz bis zur teilnehmenden Beobachtung im öffentlichen Personennahverkehr. Prickelnd wird es, wenn sich das Beschriebene und das Beobachtete reiben. Das führt zu etwas Altmodischem, dem Griff zum Notizzettel. Die Überformungen dieser Alltagssituationen führen dazu, die unerträgliche Wahrheit über den Menschen auszusprechen und dadurch die Welt erträglicher zu machen. Meine dokumentierte Fiktion Zombies ist eine Mischung aus direkter Herangehensweise und stilisierter Überhöhung in extremer Verdichtung. Mich interessiert der kaltgenaue Blick auf den Alltag. Mit kühlem Herzen habe ich Emotionen unterdrückt, um sie auf diese Art und Weise um so deutlicher zu machen.
Wörtschel: Man hat dir vorgeworfen, dich mit Zombies an Robert Altmans Short Cuts orientiert zu haben.
Weigoni: Mit der Beantwortung Deiner letzten Mail habe ich gezögert, weil es immer fragwürdig ist, Literatur thematisch einzuordnen, zudem noch dem Film unterzuordnen; aber solange es die Leute sind, die Nashville nicht kennen, ist es nicht eigentlich relevant.
Wörtschel: Sehe ich ähnlich, Nashville ist die Blaupause und Short Cuts eine schlechte Kopie des ursprünglichen Konzepts. Was also ist dein Referenzpunkt?
Weigoni: Dubliner.
Wörtschel: Ist es nicht vermessen, sich mit dem Rolls Joyce zu vergleichen?
Weigoni: „Man wird nur schlauer, wenn man gegen einen schlaueren Gegner spielt“, lautet eine Grundregel des Schach. Wenn ich an einem längeren Prosa–Stück arbeite, will ich etwas erreichen, wofür ich das Handwerk noch nicht besitze. Handwerk ist etwas, das ich mir immer neu aneignen muss. Ich werde nie fertig, begegne neuen Inhalten, und dadurch wird die Arbeit an der Prosa anders.
Wörtschel: Warum die Dubliner?
Weigoni: Mit dieser Abfolge von Erzählungen gibt James Joyce Einblicke in die städtische Gesellschaft Irlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der alte Meister zeigt darin eine Nation zwischen nationalem Aufbruch und kolonialer Mutlosigkeit, aufstrebendem Bürgertum und Emigration, der Beengtheit des Wohnens und der Sehnsucht nach der sich allmählich zu globalisierenden Welt. Seitdem sind 100 Jahre vergangen. Mein Prosageflecht Zombies verstehe ich als ein prismatisches Spiel, das in vielen Facetten aufleuchten: als leichtfüßige Komödie und ätzende Satire, als Fabel zur gesellschaftlichen Moral zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Es sind Geschichten eines Übergangs: vom Sozial- zum Individualstaat, von der Fürsorgegesellschaft zu Verhältnissen, die jeden auf sich selbst verweisen.
Wörtschel: Sprachlich bleiben die 15 Erzählungen von Joyce weitgehend konventionell, im Gegensatz zu den Zombies sind es abgeschlossene Erzählungen.
Weigoni: Oha, ich bezweifle, ob jemals etwas abgeschlossen ist. Meist gehe ich palimpsestisch vor und überschreibe die Entwürfe auf Prinzip ständig, bis sie irgendwann meiner Vorstellung von VerDichtung entsprechen. Poesie wird zu allererst aus Wörtern geformt. Die meisten Literaturkritiker scheinen vergessen zu haben, dass Prosa zuallererst aus Sprache besteht.
Wörtschel: Joyce hat etwas Ähnliches in dieser Art postuliert, Literatur sei die Ordnung intelligibler Materie nach ästhetischen Gesichtspunkten. Man bringt ja nicht nur die Sprache in eine Form, sondern all das, was die Sprache beschreibt, die Dinge, auf die sie hinweist. Man ordnet all das zu einem Gesamtkunstwerk, das allerdings erst im Kopf des Lesers entstehen sollte. Am eindrücklichsten formuliert er dies in The Dead. Seine Analyse der Gespräche auf dem Fest zeigt, dass auch die dort versammelte irische Gesellschaft voller Reibungen, voller Konflikte und voller Leben ist, welche die von ihm so gehasste Paralyse von innen aufbrechen könnten.
Weigoni: Durchaus eine Parallele. In meinen Erzählungen lernen wir Untote kennen, die in der Liebe Erlösung suchen. Diese Darsteller des niederen Selbst verkaufen sich oder lassen sich kaufen, sie handeln mit Vertrauen, Gefühlen, Sex. Die Zombies sind umgeben von kritikloser Selbstdarstellung und hemmungslosem Konsum, unersättlicher Raffgier, bodenloser Ignoranz und oberflächlichem Narzissmus. Uneingeschränkte Freiheit fällt mit absoluter Einsamkeit zusammen.
Wörtschel: Verbirgt sich hinter der Maske des Zynikers etwa ein Moralist?
Weigoni: Wenn man sich zwischen richtig oder falsch zu entscheiden hat, mag dies bei moralischen Fragen geboten sein, bei literarischen bin ich mir da nicht so sicher. Als Schriftsteller Muss ich eine intellektuelle und konzeptionelle Position einnehmen, ohne dass ich dafür die praktischen Anforderungen vernachlässige. Als denkende Menschen müssen wir vermitteln zwischen den Erwartungen, Ansprüchen und Erinnerungen der Mitmenschen, und dies setzt uns zwingend in einen Dialog mit der Condition humaine.
Wörtschel: Die meisten Ideen reifen erst durch die Beschränkung der Möglichkeiten. Dir geht es weniger um den Streit, als um die Kultur eines freien, tabulosen Denkens und Diskurses. Hat auch diese Welt eigentlich keinen Notausgang?
Weigoni: Es ist ein Leben am Wundrand der globalisierten Gesellschaft, dies ist das eigentliche Thema der Zombies. Keine Hoffnung mehr, überall nur Apathie. Was geschieht, bleibt Reflex auf den Alltag, der niemanden mehr anspornt, weil dahinter kein Traum mehr ist und eine Moral schon gar nicht. Daher kann ich dem als Schriftsteller nur mit schwarzem Humor begegnen.
Wörtschel: Nachdem die Erzählungen Zombies streckenweise rabenschwarz daherkamen, betrachtest Du mit den Novellen Cyberspasz Alltagsphänomene mit analytisch durchdringendem Blick. Dein Sound wechselt von Buch zu Buch, wenngleich die sprachliche Kraft und Eleganz wiedererkennbar bleiben. Werden mit dem Einherkommen der Trivialmythen zugleich die alten Mythen banalisiert?
Weigoni: Man kann den Sinnzusammenhang der globalisierten Welt kaum mehr erkennen, sondern den Stand der Zivilisation nurmehr in ihrer Unverständlichkeit erfassen. Auch wenn ich mich mit beginnendem Alterststarsinn wiederhole: Wir leben im Zeitalter der totalen Kommunikation bei gleichzeitiger Sprachlosigkeit.
Wörtschel: Wenn man Zombies und Cyberspasz zusammenfasst: Ein Konzeptalbum?
Weigoni: Um die Beach Boys zu zitieren: Smile:-)
Wörtschel: Man könnte bei dieser Strecke, die uns auf eine Lesereise von über 600 Seiten führt als Weigoniverse sprechen.
Weigoni: Das wäre ein Quentchen Tarantino zu viel!
Wörtschel: Es war ein Befreiungsversprechen des zwanzigsten Jahrhunderts, eines, das seinen Glanz noch immer nicht ganz verloren hat: „Die universale Maschine wird euch frei machen.“
Weigoni: Eigentlich sind es zwei Heilsversprechen. Das Zweite lautet: „Die universale Kommunikation wird euch frei machen.“
Wörtschel: Zusammengefunden haben diese Verheißungen in der Vision einer weltumspannenden Netzkultur. Das universale Computernetz, soll uns den freien Fluss der Informationen, Gedanken, Meinungen, Ideen, Bilder bescheren, und mit diesem Fluss auch den sich selbst befreiten Menschen, die Assoziation selbstbestimmter, aufgeklärter, kreativer, jedenfalls in ständigem Austausch miteinander begriffener Individuen. Bereiten soziale Netzwerke die Total-Überwachung vor?
Weigoni: Die angeblich unumgängliche Notwendigkeit des privaten Gebrauchs neuer Technologien, ohne die man bis vor kurzem ohne weiteres leben konnte, rationalisiert oft unbewusste psychische Impulse. Das Problem dieser Kommunikationstechnologien scheint mir, dass diese den Menschen eine Entscheidungsfreiheit suggerieren, die dabei zugleich verloren geht. Jede populäre neue Technik ruft zunächst massenhafte kulturelle und geistige Analphabetisierungen hervor, die erst wieder überwunden werden müssen, ehe nicht nur wenige die ideellen Potentiale der technischen Entwicklung ausschöpfen können.
Wörtschel: Hochfliegende Phantasien stürzen meist tief ab, ein Grund für dich, sich mit Dystopien zu beschäftigen?
Weigoni: Das Netz hat unser Denken verändert, und damit auch die Literatur. Dichtung ist immer ein Suchen, Versuchen, Verzweifeln, Irren und Überformen. Mit der Arbeit am Computer ist der Text jedoch weich geworden, man mag nimmer aufhören mit dem Überformen. Schrecklich schön.
Wörtschel: „Digital thinking“ und „digital reading“ stehen auf der Tagesordnung, was wie eine Verheißung klingen soll, erscheint mir als eine Form der Hochstapelei.
Weigoni: „Der eigentliche Realist… muss abwechselnd Eckstatiker und Spötter, Idylliker und Verzweifelter sein“, heißt es über Jean Paul. Eine Einengung durch ästhetische oder gar moralische Sinnprogramme kann es daher auch im 21. Jahrhundert nicht geben. Novellen haben eine Art von Integrität, die es zu achten gilt. Man kann dieser Literaturform nicht einfach Symbole einpflanzen, ohne ihr Leben zu gefährden, und doch muss man Gattungsgrenzen ausdehnen.
Wörtschel: Du beschreibt, wie Menschen auf eine Datenfolge reduziert werden, es geht in Cyberspasz nicht mehr um die Person, sondern nur noch um Vorlieben, Gewohnheiten, Alter und so weiter. Daraus lässt sich aber kein menschliches Wesen zusammensetzen.
Weigoni: In Cyberspasz probiere ich aus, wie viel erzählerische Energie in den vertrauten Mustern steckt, wenn man die Blickrichtung umdreht. Diese fünf Novellen sind eine Cyberspaceparodie (Auf ewig Dein!) auf wortprägende Agenten an der Grenze zwischen beängstigend künstlichem und beruhigend Natürlichem; gehen über in die Rock-Novelle „Der grosse Wurf“, handeln von einen leidenschaftlichen Schallplattensammler (Rahsaan, eine jazzthetische Story), spielen mit dem filmischen Nerd-Wissen (Kopfkino, ein WortVideo für eingeweihte Ohryeure) und enden mit einem Nachruf auf den Kriminalroman (Der McGuffin).
Wörtschel: Bei der Auflistung fehlen mir die Vignetten, mit denen du kurzerhand die Literaturgattung Novelle neu definiert hast.
Weigoni: Die Vignetten sind in 2009 erschienen, kurz nach Peter Meilchens Tod; auf einer Meta-Ebene auch Trauerarbeit. Es hat knapp 10 Jahre gedauert, bis wir sie als Buch/Katalog-Projekt 630 annähernd so umsetzen konnte, wie es mit dem Künstler geplant war. Der Katalog erscheint zur Gedenk-Ausstellung von Peter Meilchen am 28. Oktober in der Werkstattgalerie Der Bogen in Arnsberg.
Wörtschel: In Deinen Novellen beschreibst Du den Totalitarismus einer digitalen Technowelt, der die feindliche Übernahme des Menschen gelingt. Es ist ein Szenario, das als Kulturkritik auftritt. Wiederholt dieses Szenario Neil Postmans Verdummungsthese mit literarischen Mitteln?
Weigoni: Mr. Postman kritisiert vor allem das Fernsehen, das ein externalisiertes Medium war. Deshalb denke ich nicht, dass wir durchs Fernsehen verdummen, denn es gibt ein Leben, auch ein mediales, drumherum. Meine Novellen beschreiben einen Prozess der Internalisierung von Technologie, das Internet als Teil von uns – geistig, und vor allem körperlich. Das geschieht vor allem durch das personalisierte Internet der Algorithmen, ohne dass wir es merken. Wenn Du, ich oder der Leser dieser Zeilen bei einer Suchmaschinen nach demselben Begriff suchen, bekommen wir nicht unbedingt dieselben Ergebnisse geliefert, denn die Algorithmen rechnen im Hintergrund alle Informationen ein, die es über uns im Netz gibt, und die unterscheiden sich noch. Diese so genannten ‚Sozialen Medien’ liefern uns unterschiedliche, aber passgenaue Angebote, die Voraussetzung und Bestandteil unseres Entscheidens und Handelns werden.
Wörtschel: Warum hast Du das Genre „Cyberpunk“ und des Zopfmuster so genannten Kriminal-Romans gewählt?
Weigoni: Unter Germanisten wird die Debatte über das, was im Internet passiert, rückständig geführt. Es gibt eine Ideologisierung von Verfechtern und Gegnern des Internets, daher findet keine kulturkritische Debatte statt. Wir verstehen nicht, dass es um den Eintritt in eine neue Zivilisationsstufe geht. Es geht nicht um eine neue Technik oder eine neue Kommunikationsplattform, wir müssen hinterfragen, was von uns als Individuum übrig bleibt. Cyberspasz radikalisiert das Problem so, dass wir am Anfang einer Zukunft stehen, die ohne uns auskommt.
Wörtschel: In der neuen Zeit, die Deine Novellen entwerfen, sind wir von dem Ballast befreit, den wir seit Jahrtausenden mit geschleppt haben. Die Fragen nach dem Individuum, nach den Beziehungen zwischen den Menschen, nach Freiheit und Begrenzung, nach Liebe und Hass, nach Anfang und Ende. Wir kennen dies im klinisch-pathologischen Raum der Persönlichkeitsstörungen. Würdest Du so mir zustimmen, dass wir auf dem Weg in eine pathologische Normalkultur sind?
Weigoni: Normalität ist ein ausgehandeltes Mittelmaß. Das ist grauenvoller als jedes Extremszenario in meinem Buch. Manchmal empfinde ich unsere Gesellschaft wie in einem manisch-depressiven Dauerzustand. In Cyberspasz wird eine Gegenwart geschildert, in der das Unterscheiden unmöglich geworden ist. In der wir nicht mehr wissen, wo die Grenzlinie zwischen digitalem und ontologischem Ich verläuft.
Wörtschel: Eine Mischung von Fakten und Fiktion prägt Dein ganzes Werk. Braucht es einen Anstoß von außen?
Weigoni: Es gibt kaum etwas, was mehr Inspiration bietet, als eine Fahrt im ÖPNV. Wenn man genug von dem, was der Tag an Schrott anspült, bewusst wahrnimmt, kommen die Ideen von ganz allein.
Wörtschel: Was die Angelsachsen „sophistication“ nennen, kann man in diesen Novellen nachlesen, ein feines Wahrnehmungsvermögen im Hinblick auf soziale Verschiebungen.
Weigoni: Das ist geschmeichelt, denn ganz ohne kulturpessimistischen Zeigefinger kommt Cyberspasz auch nicht aus. Diese Novellen beschreiben auf einer Metaebene, was passiert, wenn das kulturelle Gedächtnis entsorgt wird, es verschwinden die Maßstäbe für die Leistungen der Gegenwart. Wenn wir jedoch nurmehr die kulturelle Vergangenheit sehen, verschwindet auch die schöpferische Lust auf das Neue.
Wörtschel: Im weitesten Sinn politische Literatur?
Weigoni: Den Sinn von politischer Literatur habe ich nie ganz verstanden. Wer sich für politische Botschaften in der Literatur interessiert, hat bereits eine klare Haltung zu den Dingen, die dort verhandelt werden. Entweder stimmt also der Leser ohnehin allem zu, was der Schriftsteller zu Papier bringt oder er ist eben anderer Meinung, will dann aber auch nicht mit einer Suada belehrt werden.
Wörtschel: Mit ‚Botschaften’ willst Du Deine Poesie nicht belasten?
Weigoni: Ich ziehe es vor, meine Ansichten dezent einfließen zu lassen.
Wörtschel: Autobiografische Erfahrung und literarische Fiktion, wie eng auch sie scheinbar zusammenliegen, sollte nicht verwechselt werden. Deine Prosa ist audiobiographisch?
Weigoni: Jeder Künstler versteckt und offenbart sich zugleich in seinem Werk. Innere Autarkie ist die Grundvoraussetzung des Schreibens.
Wörtschel: Haltung und Ironie sind nicht einfach unter einen Hut zu bringen. Wo die Haltung Position bezieht, ethisch oder politisch urteilt, da spitzt die Ironie die Lippen und fragt: Ehrenvoll, deine Haltung, aber folgt auch etwas daraus?
Weigoni: Ich bin nicht der einzige, der Ground Zero als einen Ort betrachtet, an dem die Abrechnung mit den Werten des Westens beginnt. Die Terror-Angriffe auf New York und Washington haben nicht nur die Architektur, sondern auch das konventionelle System staatlichen Strafens gesprengt. Die Frage nach Tätern und Opfern stellt sich im 21. Jahrhundert völlig neu.
Wörtschel: Keine Erlösung. Nirgends?
Weigoni: In der letzten Zeit wird oft von der „jüdisch-christlichen Tradition“ Europas geredet; welch verlegene Redensart. Den einzig vollständigen Religionsersatz bietet der Fußball. In einer Umwertung aller Werte ist das Fussballstadion zur Kirche geworden. Die lithurgische Abfolge und die Wechselsänge erinnert stark an eine Eucharistiefeier. Und den Glauben, dass die wahre B’russia noch einmal Deutscher Meister wird, mag ich nimmermehr aufgeben.
Wörtschel: Es gibt Autoren, die hauen nach der Adoleszenz ihren ersten Roman raus. Du hast dir für deinen ersten Roman Abgeschlossenes Sammelgebiet sage und schreibe 25 Jahre Zeit gelassen.
Weigoni: Geh mal davon aus, dass man Romane auch vom Reissbrett schreiben kann: Anfang, Zopfmuster, Ende. Man kann sich aber auch die Zeit des Nach-Denkens lassen, um einen Satz hunderte Male überdenken und bevor einem nichts Gescheites einfällt, darf man die Tastatur erst gar nicht in die Hand nehmen. Wenn man ernsthaft einen Roman schreibt, wird der autobiografische Vertrag in Stücke zerrissen. Es ist eine alte hermeneutische Erkenntnis, dass gelungene Arbeiten klüger sind als ihre Schöpfer und nicht bloss Bilderbögen von Plotpoints und konstruierten Lebensläufen. Man sollte sich Zeit lassen, den Figuren „zuhören“; diese Typen sind meist schlauer als ihr Autor.
Wörtschel: Was bedeutet Poesie?
Weigoni: Poesie ist eine Sensibilität, eine Haltung, eine Art, über Identität nachzudenken. Man kann Poesie zu einem extravaganten Stil entwickeln, campy, künstlich und artifiziell. Es kommen mehrere Dinge zusammen: Kunst, Mode und Musik. Poesie kann selbstreflexiv sein, weil sie im Kopf des Schriftstellers entsteht. Bei der hypermodernen Poesie gibt es Spuren von Performance-Kunst und Dandyismus. Es gibt Verbindungen zur Identitätspolitik, die in die Gender- und Identitätsdebatten mündete. Poesie ist immer etwas Konstruiertes, das Erfinden einer Persona, ein gesellschaftliches Re-Tuning für persönliche und soziale Transformationen.
Wörtschel: Und für dich?
Weigoni: Poesie bedeutet für mich, die Dinge anders zu denken. Es ist der Puffer, den ich zwischen der eigenen Verletzlichkeit und der Welt brauchte.
Wörtschel: Es geht es nicht darum, ob die Poesie, sondern ob das Individuum veraltet ist?
Weigoni: Das Vergängliche haltbar zu machen, ist für mich der elementare Grund zur schriftstellerischen Betätigung. Wenn ich den kostbaren Moment in meiner Prosa einfangen kann, entreisse ich ihn dem Zeitablauf.
Wörtschel: Manchen gelingt die Liebe, als hätten sie nie geübt. Andere probieren und probieren, und Frau Venus wird nie ihr guter Stern.
Weigoni: Das erste ist Leichtsinn, das zweite kann Schwermut münden. Ein Schriftsteller muss rücksichtslos gegen sich selbst sein und sich der Geschichte, die er erzählen will, auszusetzen.
Wörtschel: Hat die Verinnerlichung dieses Berufsrisikos Folgen für den Umgang des Romanciers mit seinem erfundenen Personal?
Weigoni: Gründlich über jemanden zu schreiben ist vampyrisch, man saugt den Lebenden das Blut aus, damit die Figuren in der Prosa leben können. Diese Erfahrung kann einen Autor steinhart werden lassen. Aber unter der Arbeit an diesem Roman haben sich meine Gefühle haben nicht verhärtet, sondern aber meine Haltung.
Wörtschel: Wir erzählen uns Geschichten, um zu überleben?
Weigoni: Die hypermodernen Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, nach etwas zu suchen, das grösser ist als sie selbst. Für manche Menschen die Familie oder die eigenen Kinder, für manche ist es schnöderdings Geld. Für mich ist es die Poesie. Die Tradition von Poesie reicht Jahrtausende zurück und ich bin sehr glücklich darüber, ein Teil dieses Kontinuums zu sein, Teil einer Geschichte, die Geschichten hervorbringt und zu weiteren Geschichten anregt. Literatur ist eine eigenständige Kunstform, bei der es wie bei jeder anderen dazugehört, einen Gegenstand zu betrachten, zu formen oder zu verfremden.
Wörtschel: Es gibt in Deutschland eine Tradition von politischer Literatur.
Weigoni: Immer wenn ich im Leben ins Politisieren gekommen bin, wurde mir bereits in dem Moment klar, als ich das Wort ausgesprochen hatte, dass ich die Schwelle zur Idiotie überschritten hatte. Es gibt keinen Grund, einem Leser Komplexität zu ersparen. Als politisch denkender Künstler sehe ich meine Aufgabe nicht darin, Botschaften hinauszuposaunen, sondern in einer Ermächtigung des Zuschauers. In der Haltung, ihn nicht für dumm zu verkaufen, sondern ihm ein eigenes Urteil zuzutrauen.
Wörtschel: Ist Literatur nicht auch Einmischung?
Weigoni: Literatur ist immer auch politisch, wahrscheinlich treten sogar sehr viele Bücher für Veränderungen eintreten. Allerdings verlangt das Buch per se keine Veränderungen, es dreht sich vielmehr um das, worum es in der Literatur immer geht – darum, Fragen auszuweiten, Wahrnehmungen auszuloten. Es geht um die Kosten und die Emotionen, wenn man politische Sehnsüchte direkt erlebt.
Wörtschel: „Nicht die Kunst verändert die Welt, die Welt verändert die Kunst“, hat Dürrenmatt gesagt. Kann Literatur die Welt verändern?
Weigoni: Nö. Literatur kann einen Raum zu schaffen, in dem sich Individuen zu einem Austausch treffen können, der im besten Fall den Horizont erweitert. Dieser Raum steht aber auch für Leute offen, die keine progressiven Absichten verfolgen und demokratische Werte verachten. Es hängt also immer von der Moral desjenigen ab, der sich mit der Kunst auseinandersetzt, nicht von der Moral des Kunstwerks selbst, und von Arno Breker kann einen etwas über Kunst oder über Geschichte lehren. Der Mensch ist die Instanz, nicht die Kunst, und es ist der Mensch, nicht die Kunst, der die Welt verändern kann.
Wörtschel: Müssen Schriftsteller immer in Opposition zur Gesellschaft stehen müssen – sogar zu einer Gesellschaft, für die sie selbst gekämpft haben?
Weigoni: Für Interpretationen bin ich nicht zuständig.
Wörtschel: Aber bitte, werden etwa in Abgeschlossenes Sammelgebiet nicht ganz bewusst die sogenannten 68-er gegen die 89-er ausgespielt?
Weigoni: Die politische Revolution, von der damals viel geredet wurde, ist ausgeblieben. Die Historisierung der so genannten 68-er-Generation sehe ich so, als würden sich diese Typen bei lebendigem Leib die Haut abziehen, ein Seelenstriptease eigener Art. Die so genannte ‚Alternativkultur’ hat individuelle Freiheiten ermöglicht, welche die moderne Gesellschaft insoweit verändert haben, dass Bürgerlichkeit in eine laxere Haltung überführt wurde. Ganz anders bei den 89-ern, denn ist etwas völlig Einmaliges gelungen, nicht nur eine gelungene Revolution, sondern auch eine friedliche. Mich wundert, dass dies bis heute nicht hinreichend gewürdigt wird.
Wörtschel: „Der deutsche Intellektuelle“, schrieb Reiner Kunze, „hat einen besonderen Hang zu in sich geschlossenen Denksystemen, und in denen hält er stand wie ein Zinnsoldat, der auch dann nicht schmilzt, wenn die Wirklichkeit außerhalb seines Denksystems die Hölle ist.“
Weigoni: Der Ereigniszusammenhang, für den das Jahr 1989 steht, ist bisher kaum verstanden, ich wage sogar zu behaupten, er ist kaum in die deutsche Denkgeschichte integriert worden. Es ist einfach bequemer sich als Antifaschist in der Geschichte einzurichten.
Wörtschel: In diesem Roman werden die Unplausibilitäten der 68-er zerpflückt. Woher diese Verachtung?
Weigoni: Ich hatte das grosse Glück mit einem gesunden Feindbild aufzuwachsen, personifiziert in einem Sozialkundelehrer, der einem mit einer freudianisch marxistischen Welterklärung die Lust auf das eigene Denken vermiesen wollte. Bereits in den frühen 1970-er Jahren waren die Unplausibilitäten der Antifaschismusgeschichten, sowie die Versuche, die Stimmigkeit des real existierenden Sozialismus hinzubekommen, erkennbar. Und spätestens seit 1989 ist bei den so genannten 68-er ist eine Müdigkeit des Denkens zu erkennen, die erschreckend ist.
Wörtschel: Zeitzeugen sterben aus, Erinnerung wandelt sich in Geschichte.
Weigoni: Historisches Erzählen ist nur eingeschränkt frei, bedingt durch geschichtliche Wirklichkeit, im Fall der deutschen Katastrophen vor allem aber moralisch bedrängt.
Wörtschel: Beginnt – nach der Aufarbeitung der NAZI-Diktatur – eine andere Bewältigungsliteratur?
Weigoni: Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, ich mache Kunst nicht aus politischen Gründen. Die Unterteilung in politisch und unpolitisch halte ich für fehl am Platz. Für Kunst sind solche Vorgaben nicht nur eine Einschränkung, sondern vor allem eine formale Herausforderung, die übrigens in vormodernen Zeiten ästhetischer Alltag war: Wie bewege ich mich künstlerisch in einem von Regeln, Tatsachen und moralischen Empfindlichkeiten verminten Gelände?
Wörtschel: In jedem Satz tickt die Uhr.
Weigoni: Diese Prosa mehrfach kodiert wird, sie verknüpft den metaphysischen mit dem irdischen Raum, die Religion mit der ausserparlamentarischen Bewegung, die Erzählformen der Ballade mit dem Rollenspiel der Pop-Kultur. Synchron wird in Abgeschlossenes Sammelgebiet beiläufig, reflexiv die Geschichte hinter der Geschichte erzählt, der Plot gerät zum Komplott.
Wörtschel: Bei den geschilderten Lebensgeschichten werden die Tiefenschichten der Biografien freigelegt.
Weigoni: Ein Schriftsteller ist nebenher auch ein Seelen-Archäologe der Fluchtwegen, Lebenslügen und Traumatisierungen seiner Protagonisten auf der Spur sein muss.
Wörtschel: Du schätzt beängstigende Themen?
Weigoni: Metaphysisch beängstigende auf jeden Fall.
Wörtschel: Das Ziel des Verfassers realistischer Romane ist nicht, eine Geschichte zu erzählen, uns zu amüsieren oder an unsere Gefühle zu appellieren, sondern uns zu nötigen, die dunklere und tiefere Bedeutung der Ereignisse zu bedenken und zu verstehen. Ist das Schreiben eine Fortsetzung der Liebe mit anderen Mitteln?
Weigoni: Schreiben ist die Aufzählung aller denkbaren Berührungspunkte. Der Radius meines emotionalen Verstands ist nicht gross. Trotz aller transkribierten O-Töne brauchte ich Jahre um mich genau zu erinnern. Die Erinnerung bezeugt den Mut des Schriftstellers.
Wörtschel: Nichts ist trügerischer, als die Erinnerung.
Weigoni: Hüte Dich sich vor dem Trugschluss, in der Dichtung liege die Wahrheit über den Dichter; hüte Dich, Erzählungen und Romane so zu lesen, als wären sie die verhüllte Autobiographie des Autors. Lass die Dichtung ihr Werk tun, lass Dich auf den Flügeln einer erfundenen Geschichte davontragen.
Wörtschel: Wer liest, sollte eher auf Einzelheiten achten?
Weigoni: Wer mit einer fertigen Verallgemeinerung an ein Buch herangeht, beginnt am falschen Ende und bewegt sich von ihm fort, bevor er angefangen hat, es zu verstehen. Poesie ist immer Erfindung. Alles Erdichtete ist etwas Erfundenes. Wer eine Geschichte wahr nennt, beleidigt Kunst und Wahrheit zugleich.
Wörtschel: Dichtung, so lautet ein Satz aus der Poetik des Aristoteles, sei philosophischer als Geschichtsschreibung, weil sie nicht einfach berichte, was sich im Einzelnen an bestimmten Orten zu bestimmter Zeit begeben habe, sondern weil sie das Allgemeine darstelle.
Weigoni: Die germanistischen Fliegenschissdeuter zitieren diesen Satz stolz und überspringen dabei häufig einen nahe liegenden Einwand: literarische Texte handelten oft auch von konkreten Personen. Selbstverständlich sind literarische Figuren nie aus Fleisch und Blut, sondern immer aus Wörtern gemacht, dennoch sollte Ziel das Ziel eines Romanciers darin bestehen, Figuren so erscheinen zu lassen, als seien sie aus Fleisch und Blut.
Wörtschel: Nicht alle Buchstaben dienen dem Zweck, Geschichten zu schreiben, einige bleiben als Widerhaken, um die Fragwürdigkeit des Geschichtenmachens aufzuzeigen. Führt uns also jeder Schriftsteller hinters Licht?
Weigoni: Poesie ist zu unserer Freude da, nicht dazu, dass wir uns abquälen mit der Suche nach verborgenen Bedeutungen oder Spuren aus dem Leben des Autors, die er als Material benutzt haben mag, aber hoffte, hinter sich lassen zu können.
Wörtschel: Was ist deiner Ansicht nach ein unabhängiger Schriftsteller?
Weigoni: So etwas wie einen hundertprozentig unabhängigen Schriftsteller gibt es nicht. Selbst wenn man sich vom Literaturbetrieb fernhält, steht man immer noch mit einem Bein im System, denn jeder ist auf Finanzierung und einen Vertrieb angewiesen. Für mich ist ein unabhängiger Schriftsteller jemand, der uneingeschränkt kreativ nach seinen eigenen Vorstellungen arbeiten kann. Geschichte, Thema und Machart, das sind Entscheidungen, die ein unabhängiger Schriftsteller vollkommen allein trifft, ohne dabei von irgendwelchen Saugschmerlen abhängig zu sein.
Wörtschel: Sich Zeit nehmen, sie fruchten zu lassen, das scheint das Rezept. Für die Vignetten hast Du 30 Jahre gebraucht, für Zombies 29, für Cyperspasz 26 und für Abgeschlossenes Sammelgebiet 25, ist damit der Punkt gesetzt?
Weigoni: Ich pflege an meinen Texten grundsätzlich auch nach der Publikation weiterzuarbeiten, sie sind für mich nie abgeschlossen, niemals fertig und immer verbesserbar. Die Publikation nur ein willkürlicher Punkt im Prozess des Schreibens, dem immer schon zahlreiche Varianten und Überarbeitungsstufen vorausgehen. Warum also sich mit diesem Zustand begnügen?
Wörtschel: Nie Selbstzweifel gehabt?
Weigoni: Es gibt Autoren, die in Selbstzufriedenheit schwimmen und begeistert von sich und der Welt sind. Wenn man sich die Autoren im Netz anschaut, dominiert das Selbstverständnis, sich alles zuzutrauen. Das kann ich von mir nicht behaupten, ich bin grundsätzlich allem gegenüber skeptisch. Mir wurde in keiner Waldorfschule eingebläut, wie wahnsinnig kreativ ich bin.
Wörtschel: Nie Zweifel an der Richtigkeit des Tuns gehabt?
Weigoni: Der Gipfel des Erfolges ist es, sich die Zeit zu geben, das zu tun, was man eigentlich will.
Wörtschel: 25 Jahre, wie hält man das aus?
Weigoni: Einsamkeit bedeutet für mich Frei-Sein. Freiheit bedeutet, auf den eigenen Gedanken zu beharren, inmitten der anderen, auch gegen Widerstände. Literatur ist nicht spannend, wenn alles erlaubt ist. Dichtung bedeutete für mich Freiheit, innere Rettung. Poesie ist dann am interessantesten, wenn sie Grenzen verhandelt, weitet, sprengt. Die Werke, die über jegliche Moden erhaben sind, sind meist gegen Widerstände entstanden.
Wörtschel: Zur Gattungsbezeichnung des zweiten Romans Lokalhelden, trifft „Säuferroman“ zu?
Weigoni: Das rheinische Brauhaus ist eine Universität, dort kommt man auf eine Mischung aus Prägungen und eine Mischung aus Einflüssen, aus der man sich dann mühsam aber auch lustvoll seine eigene Sprache und seinen eigenen Ton herausempfindelt. Ich sehe die Lokalhelden nicht als Säuferroman, sondern eher als einen „Heimatroman“.
Wörtschel: Heimat ist ein ideologisch strapaziertes Wort, dem nicht zu trauen ist. Ist dieser Begriff nicht kontaminiert?
Weigoni: Politiker, die Heimat politisch definieren, sie vermarkten und das Volkstum pflegen (neuerdings sogar per Ministerium) schänden den Begriff. Ich habe die „Nation“ Deutschland noch nie als meine Heimat begriffen. Das ist mir zu abstrakt für das Gefühl. Heimat hat für mich immer mit konkreter Erinnerung zu tun. Und Heimatjeföhl ist etwas zutiefst widersprüchliches.
Wörtschel: Wir leben in einem Zeitalter, das von einer eigentümlichen Dialektik zwischen Fortschrittsglauben und Historismus geprägt ist. Als jemand, der aus Polen kommt, weiss ich, als Deutscher reagiert man auf einen Begriff wie „Heimat“ gereizt.
Weigoni: Die Intelligenzija-Vobal „Kosmopolitismus“ klingt gut, verpflichtet aber zu nichts, der Roman Lokalhelden ist Plädoyer für einen lokalen Patriotismus. Die Lokalhelden sind auf einer Metaebene auch der Versuch einer Entschlüsselung von Geschichtsschreibung, eine Art von archäologischem Unterfangen. Nach der Dekodierung ist mir das Rheinland als Heimat zu eng geworden, ich werde ins Sauerland auswandern;-)
Wörtschel: Kehrt der neue „Heimatroman“ das Prinzip des Bildungsromans um, so müsste es heißen: „Fremd bin ich heimgekommen“?
Weigoni: Wenn mir jemand erzählt, es sei im Rheinischen Schiefergebirge verwurzelt werde ich sofort misstrauisch. Diese „Wurzel“-Metapher stammt aus der Blut-und-Boden-Ideologie, sie ist ebenso faschistoid, weil sie jegliche Abweichung mit dem Hinweis auf eine quasibiologische Notwendigkeit zu bergründen sucht. Es ist beispielweise ein Irrtum, dass man im Sauerland nur sauren Boden antrifft und dort am besten Tannen wachsen, am besten für den Boden ist ein Mischwald. Man sollte die Identität einer Region nicht den Identitären überlassen, dafür muss diesen Nationalisten den Begriff „Heimat“ entwenden und ihn umdeuten.
Wörtschel: Der Blick auf das Rheinland scheint mir: Es steht für die Bonner Republik, der Säufer-Kneipen und der Moderne kurz vor der Planierung. Zustimmung?
Weigoni: Im Rheinland überschneiden und überlagern sich Sprache, nationale Identität und soziale Schicht. Deutsch spricht man auf dem Amt und in der Schule – und das Rheinische eine Schweinestallsprache, immer etwas zu laut und oft „dreckelig“. Es ist seit dem Mauerfall etwas in Bewegung geraten, wohin es geht, man weiß es nicht so genau, zurück will man aber auch nicht. Die Rheinländer suchten in der Bonner Republik nach Selbstbestimmung und Freiheit, nach dem Untergang der BRD sind sie getrieben von Erlösungssehnsucht. Gemeinsam ist ihren Lebensläufen eine von Kataklysmen bedrohte Kindheit, das Gift des Faschismus wirkt nach.
Wörtschel: Die Hartnäckigkeit, mit der du den Rheinländer in die Seele schaust, schafft ungemein dichte und überzeugende Psychogramme. Wie kann Imagination das Leben umschreiben?
Weigoni: Ich habe den Lokahelden ein Gemüt mitgeben wollen. Das hat damit zu tun, dass das Rheinland gewissermassen ein Labor ist, es ist ein multiethnisches und vielsprachiges Gebilde. Mit guten Nachbarn, Brüssel oder Amsterdam sind nur zwei Stunden mit den Trans Europ Express entfernt; daher kann ich auch die Berlinfixierung beim besten Willen nicht nachvollziehen, den Strand – von Zandvoort an der Nordsee – ziehe ich allemal dem märkischen Sand vor. Es gab in der Bonner Republik eine Staatlichkeit, ohne den Anspruch, eine Nation zu werden.
Wörtschel: Das Rheinland ist bevölkert von Schattengestalten, Gespenstern und Halbtote. Diese Typen wirken zeitweise wie Widergänger der Zombies.
Weigoni: Seither bin ich oft missverstanden worden. Nicht das Verurteilen ist die Aufgabe des Künstlers, sondern das Verstehen.
Wörtschel: Kontingenztoleranz ist in der Moderne, so der Berliner Soziologe Michael Makropoulos, ein entscheidendes Kriterium. Nur wer die Zufälligkeiten hinnimmt, die ein derart eng verwobenes Handlungssystem wie die moderne Gesellschaft erzeugt, hat überhaupt die Chance, in diesem System zu bestehen. Sind die Rheinländer bestens darauf eingerichtet?
Weigoni: Es sind verschrobene Typen, welche die täglich die Sagbarkeit des Unsäglichen mit dem rheinischen Dialektrick praktizieren, demzufolge der These: Von nix kütt nix die Antithese: M’r moss och jönne könne folgt. Für jede neue These lassen sich Belege finden, man muss nur lange und möglichst einseitig suchen, je nach Tagesform variiert daher die Synthese, meist einigt man sich mit ehrfurchtsvoller Apodiktik auf den kategorischen Komparativ: Et hätt noh emmer joot jejange!
Wörtschel: Eine Rückkehr in die BRD ohne ein Wiedersehen?
Weigoni: Analog zu meinem ersten Roman habe ich die Realitätspartikel so eingefügt, dass sich das vermeintlich Vertraute als etwas abgründig Fremdes darstellt. Wo Kunst sich nicht anmasst Utopie zu sein, nicht Irritationsmittel, kann sie möglicherweise eine Brücke zur Welt sein.
Wörtschel: Es geht um das Überleben in einer Zeiten der Mittellosigkeit und eines engen Handlungshorizonts. Wie bei Abgeschlossenes Sammelgebiet hat erneut beinahe 25 Jahre gedauert, bis der zweite Roman fertig gestellt wurde.
Weigoni: Das Schreiben eines Romans ist für mich sehr zeitintensiv, man muss nicht nur fremdbestimmt das Geld zum profanen Überleben verdienen, sondern auch die Zeit erwirtschaftet haben, ehe man auf den Punkt kommt.
Wörtschel: Bevor wir das Romanlabyrinth ansatzweise erkunden, als Du zu schreiben anfingst, gab es einen Gesamtplan für diesen stark verästelten Roman?
Weigoni: Ich hatte einen Plan, aber der Plan änderte sich während der Arbeit. Man kann sich das so vorstellen, als ginge man mit einem Stadtplan in eine fremde Stadt und schaute dann gar nicht hinein. Man könnte im Notfall immer darauf zurückgreifen. Aber wie jede Reise wird das Schreiben sehr viel aufregender, wenn man sich öffnet für Überraschungen für die Poesie der Strasse und die Magie des Moments.
Wörtschel: Man soll sich darin verlaufen?
Weigoni: Nicht absichtlich. Der Leser sollte das Gefühl haben, er befinde sich die ganze Zeit auf dem vorgesehenen Pfad, bis er sich irgendwann fragt: „Wie bin ich denn hierhergekommen?“ Als Schriftsteller versuche ich, genau das zu erreichen. Nur, wenn etwas mich selbst überrascht, überrascht es auch die Leser. Die sind sehr clever und merken sofort, wenn etwas zu sehr geplant ist.
Wörtschel: Eine Poesie der Gosse?
Weigoni: Poesie ist vor allem eine Art zu leben. Und erst dann kommt die Frage, wie man davon leben oder besser gesagt überleben kann.
Wörtschel: Der Roman ist voller Geschichten, die man nicht abspalten kann. Beim Lesen ist es sehr entspannend, man muß sich nicht auf Hautfiguren konzentrieren, weil der Roman nur aus Nebenfiguren besteht. Ist man als Schriftsteller der Schizophrenie ausgeliefert?
Weigoni: Manchmal muss man ungewöhnlich Methoden anwenden, um die wohl überlegten Grundsätze zu bewahren. Schreiben ist die sozial akzeptierte Variante der Polyphrenie. Die Schaffung eines Individuums ist keine Leistung. Und eigentlich ist Literatur auch keine Leistung.
Wörtschel: Aber sie kann als Leistung angesehen werden?
Weigoni: Glücklicherweise gibt es für Literatur keine Weltranglistenpunkte.
Wörtschel: Lokalhelden ist auch eine Untergangsgeschichte. Der Roman erzählt vom Abschied von der alten BRD, von Manieren und vom bürgerlichen Lebensstil. Er handelt von mehr als nur den Folgen des kalten Krieges.
Weigoni: In den Lokalhelden geht es um die Pluralität von Freiheiten. Ich misstraue dieser auch in der politischen Linken verbreiteten Perspektive, dieses Universal von Technik, Kapital, Medium würde vor allem Unfreiheit produzieren. Die Rheinländer bewegen sich in einer Pluralität von Freiheiten und verstehen, haben intuitiv begriffen, dass sich diese Freiheiten gegenseitig ausschliessen.
Wörtschel: Sollte man, wenn es um Geschichte geht, den Fakt der Fiktion vorziehen?
Weigoni: Es geht nicht um Fiktion oder Faktion – es gibt nur das Erzählen von Geschichten. Beim Schreiben interessiere ich mich für den Prozess des Schreibens. Es macht mich neugierig, zu erkunden, was zeitgemässe Literatur sein könnte. Daher compiliere ich derart, dass die fiktionalen Abhandlungen auf die nichtfiktionalen stossen, immer spannend zu sehen, was unter der Arbeit dabei herauskommt. Ich habe kein Interesse daran, Wirklichkeit abzubilden. Ich möchte zeigen, wie die Wege des Vergessens und Erinnerns sich kreuzen. Erinnerungen sind im Rheinland fliessend, sie ändern sich ständig. Die Rheinländer erfinden sich ständig im Reden neu.
Wörtschel: Eine der grössten Selbstlügen der Kunst lautet, sie verbinde Menschen. Meist ist das Gegenteil der Fall. Spätestens seit den Zombies hast Du einen Blick für die Barbarei unter dem Firnis der Zivilisiertheit.
Weigoni: Es geht mir nicht um authentische Landschaftsbeschreibungen des Rheinlands als vielmehr um ein Ausbuchstabieren der inneren Regungen ihrer Figuren. Topologie bedeutet wörtlich übersetzt: Logik des Ortes; also auch einer Redeweise, einer bestimmten Einrichtung von Orten in der Welt. Die poetische Topologie, die ich mit dem Rheinland verbinde, bedient sich der Mythen, Erzählungen, Narrative. Und nicht zuletzt dem schnoddrigen Dialekt.
Wörtschel: Der dominante Eindruck des Romans ist eine tiefe Erfahrung von Fremdheit, die nur dort entstehen kann, wo man eigentlich Vertrautheit erwartet. Es ist ein absichtsvoll konstruiertes Vexierspiel aus vielen Realitätsschichten. Gehören diese verengten Sichtfelder zum Konzept?
Weigoni: Die Fiktion, die im Rheinland ein neues Licht auf die Realität wirft, wird ständig mit Realismus vergiftet, sodass sie als Fiktion wie als Spiegel der Realität einer erbärmlichen Lüge gleichkommt. Ironiker sind hier gelangweilte Moralismen, denen es noch viel zu gut geht. Falls noch eine grosse Aufgabe anliegt, sollte man das Projekt der Aufklärung fortsetzen.
Wörtschel: Romane verschlüsseln oft eine Zeitdiagnostik, chiffrierten Aussagen können nicht einfach in prosaische Thesen übersetzt werden. Wie also in den gesellschaftlichen Echoraum hineinhören?
Weigoni: Literatur kann kein politisches Engagement ersetzen, sie ist bestenfalls brauchbar als Echolot. Während Literatur in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts eine künstlerische Reaktion auf gesamtgesellschaftliche Transformationsprozesse war, kehrt im 21. Jahrhundert ein Individualisierungsprozess ein. Sprachfragen sind seit jeher politische Fragen. Diese Form der Wirklichkeitserfassung ist ein Herrschaftsinstrument und die Frage, was die Herrschenden mit ihr anstellen, ist für einen Schriftsteller ebenso interessant wie das Verhältnis, das man beispielsweise zur Form des Romans hat.
Wörtschel: Literatur ist somit kein Teil der Widerstandsbewegung mehr?
Weigoni: Grundsätzlich bin ich ein sturer Mensch, manches ändert sich bei mir nie, mein Verständnis der Welt, meine Geisteshaltung, meine Werte, meine Überzeugungen, alles was Meinungsfreiheit betrifft. Aber ich höre nicht auf, an Verständigung und Kommunikation zu glauben. Jede Literatur ist, solange sie nicht korrumpiert ist, politisch.
Wörtschel: Literatur sollte also eine Botschaft haben?
Weigoni: Wer eine Botschaft hat, sollte sie aufschreiben und per Schneckenpost versenden. Literatur macht uns nicht besser, es ist keine Universität, keine Schule und auch kein Krankenhaus. Ich versuche, die Literatur mit Humor zu nehmen. Es gibt Momente von Intensität, für die sich die Arbeit lohnt. Man darf nicht zynisch werden und muss davon überzeugt sein, dass man etwas mitteilen kann.
Wörtschel: Dein Heimatroman Lokalhelden ist somit das Sittengemälde einer Gesellschaft im Umbruch.
Weigoni: Mich interessiert die Innenschau, der Blick hinter die morsche Fassade einer Gesellschaft, die permanent auf ihre moralische Stabilität verweist. Dieser Roman gleicht einem öffentlichen Verkehrsmittel, er bietet Platz für viele verschiedene Passagiere und funktioniert in einer offenen Struktur, ohne einen konstruierten Zusammenhang. Nichts im Leben hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, nur Hollywood besteht darauf.
Wörtschel: Im Zentrum deiner Romane steht die Menschenbeobachtung, der Rheinländer. Zu faul um zu recherchieren?
Weigoni: Aber bitte, wir täuschen uns über das Glokale, im Bezug auf unsere Herkunft gibt es keine Gewissheit. Nicht einmal seine eigene Geschichte kann man mit Gewissheit erzählen. Bevor es das Internet gab, wussten die Rheinländer nicht, was jenseits ihres Fischerdorfes geschah. Diese Gewissheit gibt es nicht mehr. Die Rheinländer wissen von allen Grausamkeiten, die täglich irgendwo auf der Welt passieren. Und sie weigern sich beharrlich das zu akzeptieren.
Wörtschel: Schlägt die Handlung andere Wege ein, weil es die Figuren so wollen?
Weigoni: Die Rheinländer haben ihre eigene Logik und Dynamik, zuweilen muss man ihr nur folgen, was aber nicht bedeutet, dass sich die Geschichte von ganz allein schreibt.
Wörtschel: Hannah Arendt schreibt zur Natalität: „Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, d.h. zu handeln.“
Weigoni: Das Leben ist erheblich intelligenter als die Literatur, was ich schreibe, ist nicht wirklich die Geschichte, das Material enthält allenfalls Elemente, die eine Geschichte ausmachen. Es gibt bei den Lokalhelden keine Hierarchie der Nebensätze, dadurch entsteht ein Strom, durch den Sprache fliessen kann, einfach nur der dyonisische Akt, diese eine Nacht, ein Chor von endlosen Stimmen in einer Endlosschleife – und nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Der Versuch ein Zeitalter festzuhalten, das uns längst entglitten ist.
Wörtschel: Obschon dieses Land mit der Rheinischen Sinfonie von Robert Schumann eine eigene Hymne hat, kann man es nicht als Staatsgebiet bezeichnen. Ist die rheinische Bucht, ein Rückzugsgebiet?
Weigoni: Im Rheinland bin ich nie angekommen, aber ich habe es aufgesogen. Das Sauerland betrachte ich eher als Rückzugsraum. Das Leben in Selbstisolation ist dort wunderbar. Im Rheinland kann man experimentieren, man kann sich irren, doch niemand will Fehler machen, niemand will sich hier irren, alle wollen Sieger der Geschichte sein; auch ihrer eigenen Lebensgeschichte, über die sie keinesfalls die Deutungshoheit verlieren wollen. Aber das Rheinland funktioniert deshalb, weil man hier Fehler zulässt. Aus ihnen habe ich gelernt, alles Neue beginnt als ein Fehler; auch im Land der tausend Berge.
Wörtschel: Es hat den Anschein, als habe der Literatur-Betrieb ausgedient, da Antibürgerlichkeit auf ein bürgerliches Publikum angewiesen ist. Bleibt uns nur noch ein stilvolles Scheitern?
Weigoni: Die dem Rheinländer stets angedichtete Leichtigkeit des Seins paart sich zuweilen mit einer gewissen Unbedarftheit der Wahrnehmung. Ich schätze ihren Anti-Establishment-Individualismus. Und abschliessend bleibt zu hoffen, dass meine liebevolle Verbeugung vor dem rheinländischen Widerspruch so verstanden wird, wie er angelegt ist.
***
Lokalhelden, Roman von A. J. Weigoni, Edition Das Labor, Mülheim 2018 – Limitierte und handsignierte Ausgabe des Buches als Hardcover.
Erhältlich über: info@tonstudio-an-der-ruhr.de
Coverphoto: Jo Lurk
Weiterführend →
Lesen Sie auch das Nachwort von Peter Meilchen sowie eine bundesdeutsche Sondierung von Enrik Lauer. Ein Lektoratsgutachten von Holger Benkel und ein Blick in das Pre-Master von Betty Davis. Die Brauereifachfrau Martina Haimerl mit Hintergrundmaterial. Ein Kollegengespräch mit Ulrich Bergmann, bei dem Weigoni sein Recherchematerial ausbreitet. Constanze Schmidt über die Ethnographie des Rheinlands. René Desor über die untergegangene Bonner Republik. Denis Ullrich mit einem Rezensionsessay.
→ Lesen Sie auch den Essay Laik Wörtschel – ein Künstler der Stille.
→ Ein Artikel von Laik Wörtschel über Asphaltics – die geheime Streetart.
→ Wir begreifen die Gattung des Essays auf KUNO als eine Versuchsanordnung, undogmatisch, subjektiv, experimentell, ergebnisoffen.