Am Abend setzte ich mich in den Jardin du Luxembourg und las Joseph Conrads Erzählung Herz der Finsternis. Das lenkte mich ab, obwohl mich das Ungesagte oder Unsagbare, das Mr. Kurtz so bewegte, das entsetzliche Gesicht einer flüchtig erblickten Wahrheit, an mein eigenes Schicksal erinnerte. Ich wusste es nicht genau, ich schob auch das weg von mir. Ich war müde, ging in der späten Abenddämmerung zum Hotel zurück (das Fenster im ersten Stock war geschlossen, die Fensterläden standen halb geöffnet) und kroch unter die Decke.
Schüttelbilder. Auf abschüssigem Gelände, am Rand der Stadt erbaut, steht der Palast. Innen wiederholt er seinen Grundriss in den ineinander geschachtelten Gängen und Fluren, Torbögen und langen Kolonnaden, die spitzwinklig aufeinander zulaufen. Das Licht flutet die großen Hallen, Säle, Treppenaufgänge, Flure, Erker, Zimmer und Zellen. Links öffnet sich ein Atrium mit Arkaden, rechts ein Forum mit Säulenkreis im Quadrat. Darüber wölbt sich der Himmel. Keine Glaskuppel, sondern ein weites blaues Sinusgebilde aus Nichts. Kein Wind strömt ins Haus, keine Sonne. Ein Haus ohne Dach, ohne Möbel und Teppiche.
Ich laufe über marmorne Spiegel. Die Wände sehen dich an. Federnde Waden, rotierende Oberschenkel gliedern den Raum. Kein Rumpf, keine Arme und Hände, kein Kopf, der in den hellen Himmel ragt. Der Palast schwankt, aber er läuft nicht fort. Er ankert auf der schiefen Ebene. Auf den Kuppen der Mauern wuchert Blumengras im Gegenlicht, die Halme stechen schwarz ins Blaue. Weißgelbes Licht strahlt aus den Steinen. Mir wird warm. Ich bin allein. Nun sitze ich an einem kahlen Tisch, der den Raum ausfüllt. Mir gegenüber sitzen zwei stumme Frauen. Neben ihnen leere Stühle. Kein Himmel über mir. Was für eine dunkle Kammer, so grau, so fahl, so stumm. Die Frauen schauen durch mich hindurch. Ich schweige. Das Steintuch wirft scharfe Falten in der Mitte des Tischs. Die Frauengesichter schimmern hell im Schattenschwarz. Hinter mir klirrt Wasser. Ich stehe auf und laufe zum Gang. Ich sehe mir auf den Rücken, beobachte kalt, wie ich aus der Dunkelkammer falle. Der Gang wird enger. Im Gegenlicht stehen zwei Jungen, sechs oder sieben Jahre alt. Sie reden auf mich ein, indem sie mich aus großen hellblauen Fischaugen anstarren. Ich höre Fremdwörter und schwierige Sätze. Ich verstehe kein Wort. Ich schaue zu Boden. Der ist so schwarz, als wäre er das Nichts, in das ich falle, wenn mich meine Augen nicht festhalten. Unter meinen Füßen brennt keine Sonne. Die Jungen sprechen schneller, die Worte rasen mir in die Augen. Ich stehe da mit offenem Mund und kann nicht sprechen. Die Zunge ist taub. Mein Blut klopft ins Hirn. Die Jungen rennen an mir vorbei. Ich drehe mich um und schaue ins rotgelbe Gefüge der Steine. Ich bin allein. Langsam laufe ich durch Innenhöfe und Tore, plötzlich stehe ich vor der tausendfältigen Villa auf fester rötlicher Tonerde, von Rädern tief durchfurcht.
Ich blicke in tote Gassen. Die Häuser haben keine Fenster, keine Türen, kein Dach. Die Mauern sind schwarz, verwittert, verbrannt. Hier lebt niemand. Ich bin in einer anderen Zeit. Hier schnitt ein Sturm Stücke aus der Nacht. Da wächst eine rotbraune Wunde unterm Block der Wolken. Nun fällt ein Licht vom Himmel, breit und allgemein, da ist die Sonne ausgelaufen. Ein blauer Mond tropft Eis über den Himmel, sät kalte Todeskeime in den Luftacker. Ich schau ihm ins Gesicht, seine Augen sind entzündet. Der Totenkopf wackelt und reißt den Saum der Farben ein. Ich friere. Ich suche Halt und lehne mich an die Wand eines zerbrochenen Hauses. Sie ist hart und kalt, aber ich falle nicht. Die Frauen aus der dunklen Kammer reden mit geschlossenen Augen auf mich ein. Der Mond ist tot, höre ich die eine sagen. Er schwimmt über dem Himmel, sagt die andere.
Ich schaue hinüber zum Palast, der steiler sich hinabsenkt über den Hang. Da komme ich her, da schläft das Licht. Ich stoße mich ab von der Wand, überquere die tönerne Straße, dränge mich durchs Tempeltor. Ich will ins Atrium, wo Himmelblau auf den Grund des schwarzen Wassers sinkt.
***
Gionos Lächeln, ein Fortsetzungsroman von Ulrich Bergmann, KUNO 2022
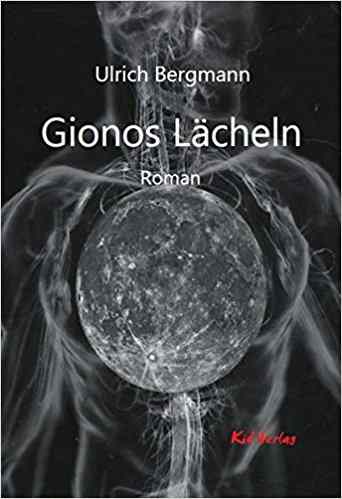
Vieles bleibt in Gionos Lächeln offen und in der Schwebe, Lücken tun sich auf und Leerstellen, man mag darin einen lyrischen Gestus erkennen. Das Alltägliche wird bei Ulrich Bergmann zum poetischen Ereignis, immer wieder gibt es Passagen, die das Wiederlesen und Nochmallesen lohnen. Poesie ist gerade dann, wenn man sie als Sprache der Wirklichkeit ernst nimmt, kein animistisches, vitalistisches Medium, sondern eine Verlebendigungsmaschine.
Weiterführend →
Eine liebevoll spöttische Einführung zu Gionos Lächeln von Holger Benkel. Er schreib auch zu den Arthurgeschichten von Ulrich Bergmann einen Rezensionsessay. – Eine Einführung in Schlangegeschichten finden Sie hier.