„Dmitrij Schostakowitsch legte sich jahrelang abends mit voller Kleidung ins Bett, neben ihm der gepackte Koffer“, sagte Stella, „er lebte in der ständigen Angst, deportiert und liquidiert zu werden. Dem Diktator missfiel die neunte Sinfonie, es fehlte der Triumph, die Musik war zu friedlich, zu leise, viel zu subtil, ein Rückfall in den kalten westlichen Formalismus, das war ja fast Haydn, was da erklang. ‚Dschugaschwilis Lehre’ war, so hieß es, ‚der sublimierteste Ausdruck des menschlichen Geistes und nicht anders zu fassen und zu erklären als wie kraft einer streng herrschenden Ideologie.’ Und das steckte nicht in den Noten dieser Sinfonie. Schostakowitsch war in den Augen der Partei renitent, er hoffte auf Wunder, auf die falsche Freiheit, er wollte Würde, Glück, Recht und derlei Plunder, das war Gotteslästerung, Glaubensschändung, Hochmut, Ungehorsam gegenüber der heiligen Lehre, und so gesehen schon Aufwiegelung, freches Widersprechen, Zweifeln, ja Selberdenken. Eines Tages liest Schostakowitsch am Schwarzen Brett des Leningrader Konservatoriums, dass ihm die Lehrbefugnis als Professor entzogen worden war – wegen seines ‚niedrigen Fachniveaus’. Der zehnjährige Sohn wurde in der Musikschule gezwungen, die Schandtat seines Vaters zu verdammen, der zum Volksfeind erklärt wurde. Er hatte Angst, hingerichtet zu werden wie viele andere, er fürchtete um das Leben seiner Mutter, seiner Frau, seiner Kinder. … Er konnte kaum schlafen. Das Fenster war einen Spalt geöffnet, damit er jedes Geräusch auf der Straße mitbekam. Im dunklen Zimmer lauschte er, ob ein Auto vor dem Haus anhielt. Eines Nachts fuhr eine schwarze Limousine vor. Schostakowitsch stürzte ans Fenster und sah, wie drei kräftige Männer die Straße überquerten. Unten schlug die Haustür, der Aufzug setzte sich in Bewegung, stoppte. Schostakowitsch stand an der Tür zum Flur, die Fahrstuhltür knallte zu, Schritte hallten im Treppenhaus, kein einziges Wort fiel, dann klingelte es in der Nachbarwohnung. Die Tür wurde geöffnet, wieder fiel kein Wort. Nach einer Weile kamen die Schritte zurück, die Wohnungstür fiel zu, die Männer bleiben stehen, einer scharrt mit dem Fuß auf dem Steinboden. Kein Wort, die Schritte kommen näher, Scharren, dumpfes Husten, sie entfernen sich, die zuklappende Fahrstuhltür, das Summen, die Schritte auf dem Kopfsteinpflaster, das Quietschen der Karosserie, zuschlagende Türen, der Motor heult auf. Langsam dehnt sich im Ohr die Stille aus … Seit dieser Nacht wusste er, er war verloren, sinnlos seine Wache. Er zog im Dunkeln die Jacke aus, dann die Schuhe, und legte sich schlafen … In dieser gefrorenen Zeit schrieb er das Violinkonzert, das erste, ein wildes Zappeln der Einsamkeit. Als Stalin starb, heulten die Sirenen, sie hörten gar nicht wieder auf vor lauter Freude.“
***
Gionos Lächeln, ein Fortsetzungsroman von Ulrich Bergmann, KUNO 2022
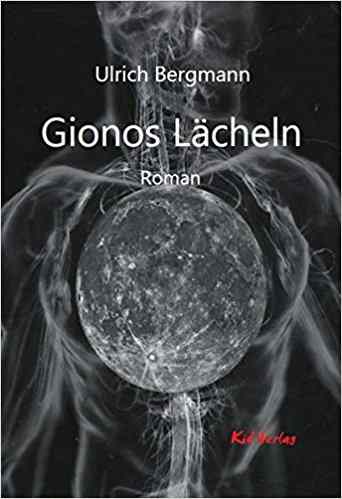
Vieles bleibt in Gionos Lächeln offen und in der Schwebe, Lücken tun sich auf und Leerstellen, man mag darin einen lyrischen Gestus erkennen. Das Alltägliche wird bei Ulrich Bergmann zum poetischen Ereignis, immer wieder gibt es Passagen, die das Wiederlesen und Nochmallesen lohnen. Poesie ist gerade dann, wenn man sie als Sprache der Wirklichkeit ernst nimmt, kein animistisches, vitalistisches Medium, sondern eine Verlebendigungsmaschine.
Weiterführend →
Eine liebevoll spöttische Einführung zu Gionos Lächeln von Holger Benkel. Er schreib auch zu den Arthurgeschichten von Ulrich Bergmann einen Rezensionsessay. – Eine Einführung in Schlangegeschichten finden Sie hier.