Ich bin dann mal weg. Es gibt diese Geschichten vom Abhauen, da sagt einer, er geht Zigaretten holen und kommt nicht wieder. In diesen Stories verlässt immer der Mann die Geliebte, die Frau, mit der er zusammen wohnt, aber die Geschichte bleibt stets unerzählt, sie wird nur angedeutet, ihr fragmentarischer Charakter verweist auf einen Zwang zur Flucht, der aus der Kollision zweier tief eingewurzelter Gefühle erwächst: Der Drang nach der Unverletzlichkeit des Ichs: eine Lunte im Schacht einer Leidenschaft, in der sich die Liebenden gegenseitig auffressen, bis die Selbstbefreiungsbombe platzt.
So erging es mir, als ich mich mit Stella zu langweilen begann, unsere Liebe kühlte ab. Wir kannten alle Pariser Altäre. Wir diskutierten zuviel, wir philosophierten derart hypertroph über uns selbst, dass wir uns eingruben wie die Zikaden und auf unsere Verwandlung warteten. Alle siebzehn Jahre kriechen die zirpenden Heerscharen von Larven der Spezies Magicicada septendecim aus dem Boden, um sich zu paaren. Stella hatte die Idee, unsere Liebe mit den Zikaden zu vergleichen. Einer unserer Standarddialoge, wenn wir über die Bilder debattierten, die wir von uns selbst und vom anderen entwarfen: „Janus, hör mir mal gut zu …“ „Ich weiß.“ „Nichts weißt du.“ „Doch, die Zikaden …“ „Janus, genau darüber wollte ich mit dir reden.“ „Wir sind keine Zikaden!“ „Janus, ich hab dir schon siebzehn Mal gesagt, ich fresse dich nicht auf!“ Oder umgekehrt: „Stella, ich habe dir schon siebzehn Mal gesagt, ich fresse dich nicht auf.“ „Du wirst immer schlimmer, Janus.“ „Stella, ich bin keine Zikade.“ „Genau darüber will ich mit dir reden, Janus.“
Siebter Schritt. Manchmal brennen zwei Lunten zur gleichen Zeit. Es blieb unklar, wessen Bombe zuerst explodierte, ihre oder meine. Vor Wochen, als wir über Ronchamp und Colmar nach Straßburg fuhren, hatten wir im Musée d’Art Moderne vor einem unfasslichen Bild gestanden, eine riesige Fotografie auf einer sechs mal vier Meter großen Leinwand. In eine glatte senkrechte Felswand gehauen war in riesigen römischen Lettern ein Zettel, wie wir ihn schreiben, wenn wir mitteilen wollen, dass wir gleich wieder da sind. Mitten in einem vielleicht schweizerischen Gebirgspanorama stand diese Mitteilung, ein Altar tagtäglicher Liebe:
SUSAN,
OUT FOR A PIZZA.
BACK IN FIVE MINUTES.
GEORGE
Ich änderte den Text ab, aber ich war sicher, Stella würde das kalligraphische Scherzo wiedererkennen. Ich ritzte die Worte mit schwarzer Feder aufs Papier, steckte die Zeichnung in einen Umschlag und schickte Stella den Brief in die Rue Grenelle, nur ein paar Schritte vom „Dragon“ entfernt. Ich brauchte die zärtliche Ironie eines besonderen Abschieds, nur so war das Ende unseres intimen Diskurses rund. Ich verachtete die herabwürdigenden Mails oder SMS, die sich viele schicken, um sich noch einmal zu verletzen, wenn sie Schluss machen. War ich weit davon entfernt?
Mein Kopf will platzen vor lauter Ideen. Die Sachen fallen mir zu, aber ich kann mich selbst nicht schreiben. Meine Hand ist gelähmt. Meine Zukunft starrt mich nicht an. Meine Augen sehen innen nach oben. Über mir herrscht Stille. Bewegungslosigkeit in mir. Der Schlussstein in meinem Gewölbe fällt nicht.
Ich kann die dunklen Gedanken nicht wegschieben. Ich sehe mich durch die Finsternis der Unterwelt tapsen. Die Totenseelen dürsten alle nach Blut. Nun gut, man kann ihnen Honig, Wein und Gerste geben oder Gerstenmehl. Der Monoprix-Laden in der Rue de Rennes verkauft Semmelbrösel. Ich frage die Verkäuferin, ob das als Totennahrung taugt. Sie weiß es nicht. Wahrscheinlich fehlen repräsentative Erfahrungswerte. Der Höllenhund mag jedenfalls Honigkuchen. Beliebte Totengaben waren in der Zeit, als der Kosmos noch ganz war, Nektar, Ambrosia, Soma, Amrita, Milch, Butter, Sahne, Öl, Eier, Brot, Getreidesamen, Reiskörner, Sesam, Pfannkuchen, Nüsse, Äpfel, Pflaumen, Fruchtkerne, Schokolade, Wurst, Muscheln, Fisch, Bier, Wein, Schnaps, Tabak, Blut und sogar, etwa in afrikanischen Urvölkern, Menschenfleisch. All das war ins Jenseits mitzunehmen. Den Toten nur das Beste, dachte man früher. Wie sehr die Toten heute ausgegrenzt werden, erkennt man daran, dass es kein Kochbuch fürs Jenseits gibt.
***
Gionos Lächeln, ein Fortsetzungsroman von Ulrich Bergmann, KUNO 2022
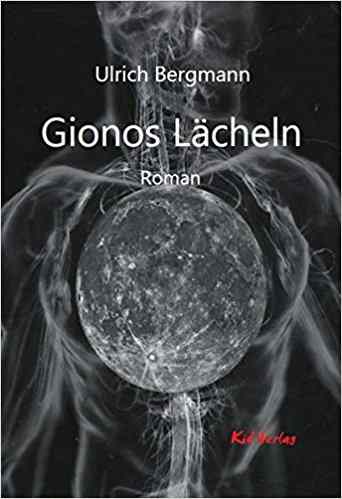
Vieles bleibt in Gionos Lächeln offen und in der Schwebe, Lücken tun sich auf und Leerstellen, man mag darin einen lyrischen Gestus erkennen. Das Alltägliche wird bei Ulrich Bergmann zum poetischen Ereignis, immer wieder gibt es Passagen, die das Wiederlesen und Nochmallesen lohnen. Poesie ist gerade dann, wenn man sie als Sprache der Wirklichkeit ernst nimmt, kein animistisches, vitalistisches Medium, sondern eine Verlebendigungsmaschine.
Weiterführend →
Eine liebevoll spöttische Einführung zu Gionos Lächeln von Holger Benkel. Er schreib auch zu den Arthurgeschichten von Ulrich Bergmann einen Rezensionsessay. – Eine Einführung in Schlangegeschichten finden Sie hier.