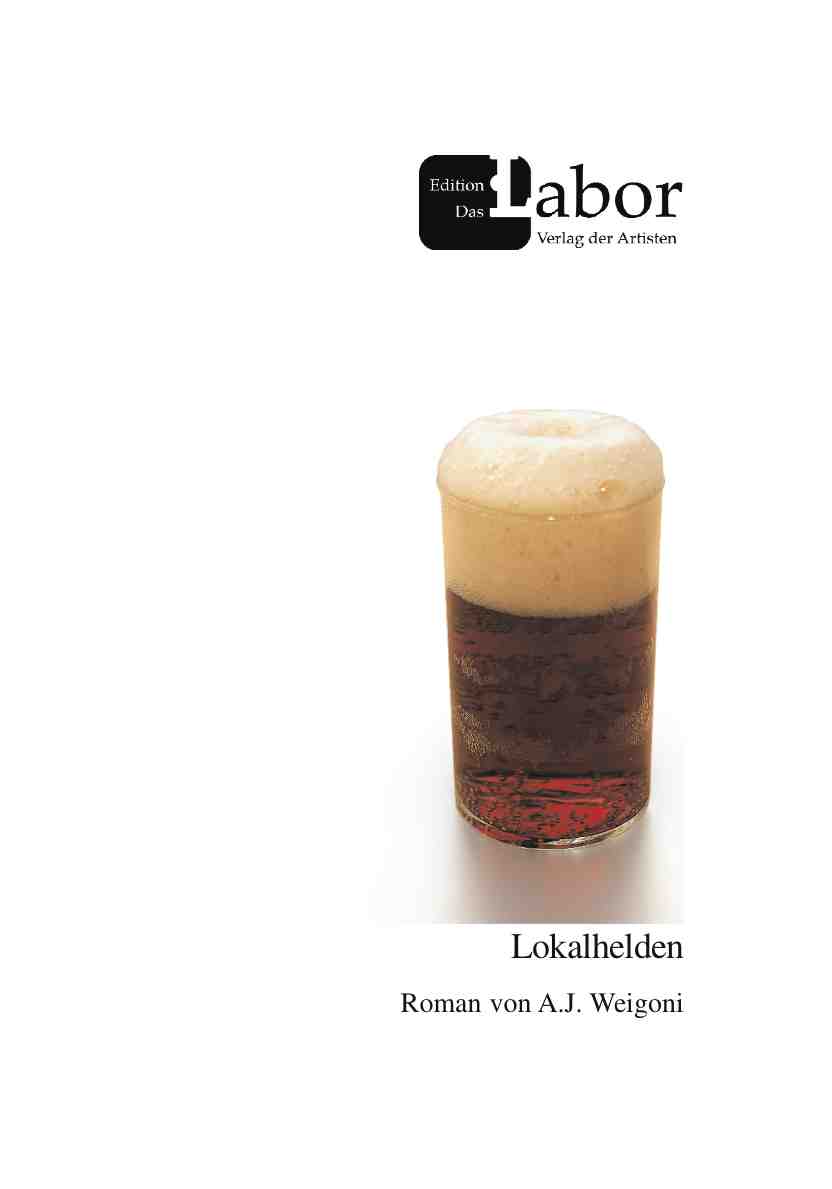Allen Schriften von Heinrich Heine gehen prachtvolle, blendende Vorreden voran. Diesmal hält der Verfasser seinen Einzug, gefolgt von dem Kaiser Otto und Karl dem Großen, von zwei Bischöfen und einem Grafen, ein ehrwürdiger Aufzug, der aber die Unannehmlichkeit hat, daß er zu sehr die Aufmerksamkeit und Neugierde erweckt. Man glaubt nicht, wie viel eine schöne Vorrede dem Buche, welches ihm folgt, schaden kann; es bedurfte des ganzen Genie’s von Rossini, um eine Oper wie die Gazza Ladra, deren Ouvertüre mit einem Trommelwirbel beginnt, glücklich durchzuführen.
Aus gewichtigen Gründen werde ich nicht in die Einzelheiten des Werkes von Herrn Heine eingehen; ich werde mich begnügen, den Geist desselben zu prüfen, d.h. den Geist des Verfassers überhaupt. Erstens sind meine Kenntnisse von der deutschen Filosofie und Literatur in ihrer Gesammtheit und in ihrer historischen Entwickelung sehr oberflächlich, und obgleich ich mich darin von Herrn Heine nur durch die Offenheit meines Geständnisses unterscheide, so nöthigt mich doch die Redlichkeit, mich als unbefugt zu einem Urtheile über derlei Dinge zu erklären. Alsdann fehlt mir der Mut, mich zu offen der Vorsehung zu widersetzen, welche Herrn Heine, wie er uns versichert, beauftragt hat, Frankreich mit Deutschland bekannt zu machen. Das wäre ein allzu gewagtes Unternehmen, vorzüglich seit die Vorsehung des Herrn Heine sich unter den Schutz eines einflußreichen Ministers gestellt. Ich will mich nicht mit ihr entzweien.
Wenn Herr Heine von dem Auftrag spricht, den ihm die Vorsehung gegeben, so handelt es sich, wohlverstanden, um einen Auftrag in Bezug auf Paris; denn was einen Auftrag in Bezug auf Frankreich betrifft, so hätte sich Herr Heine geschämt, ihn anzunehmen. Er drückt sich darüber deutlich aus: »Unter Frankreich, sagt er, verstehe ich Paris und nicht die Provinz; denn was die Provinz denkt, bedeutet ebenso wenig, als was unsre Beine denken. Der Kopf ist der Sitz unserer Gedanken.« Ohne Zweifel hat Herr Heine diese kostbaren Worte aufgezeichnet, als er nach einer Abendgesellschaft bei einem adligen Bürger nach Hause zurückgekehrt war und seine Glacéhandschuhe noch nicht ausgezogen hatte. Seine Rede hat den unvergleichlichen Geruch jenes Wassers von tausend Unverschämtheiten, womit allein die Salons des Jüstemilieu durchduftet sind. Doch, wahrlich das geht über den Scherz. Was Frankreich seit fünfzig Jahren Großes gethan, ist das von den Parisern erdacht und ausgeführt worden? Sind Necker, Mirabeau, Sieyes, Barnave, Camille Desmoulins, Pethion, Roland, Robespierre Pariser gewesen? Sind Carmot, Dumouriez, Hoche, Kleber, Moreau, Desaix, Massena, Ney, endlich Napoleon, nicht Provincialen gewesen? Nein, Paris ist nicht das Haupt Frankreichs, es ist nur dessen Hut, und wenn es der Provinz jemals zu warm werden sollte, so würde sie nicht lange schwanken und den Hut abnehmen. Wäre es möglich, daß diese glänzende Rede des Herrn Heine der getreue Ausdruck der Gesinnungen der Pariser sei? Dann wehe ihnen! Eines Tages könnte es allen Franzosen in den Sinn kommen, Paris sei Frankreichs Bastille, und an diesem Tage würde es fürchterlich heiß hergehen. Die Pariser sollten diese Saite nicht berühren. Wenn sie so weit gekommen, Versailles und den alten Hof zu ersetzen und die Börse in ein œil de bœuf zu verwandeln, so müßten sie sich ruhig ihrer Oberherrschaft erfreuen und sich ihrer nicht laut rühmen. Zittern sie nicht bei der Vorstellung man könnte eines Tages auf dem Platze der Chaussee d’Antin eine Stange aufgepflanzt sehen mit der Inschrift: Hier weint man?
Herr Heine spielt in seinen in französischer Sprache herausgegebenen Schriften bei Frankreich den Angenehmen und schmeichelt ihm auf wahrhaft wenig schmeichelhafte Weise. Er behandelt es als Buhlerin und sagt ihr Galanterieen, aber Galanterieen, um die Straße des Lombards neidisch zu machen. Er sagt den Franzosen, d.h. den Parisern, obwol sie keine Heiden mehr wären, führen sie doch nicht minder fort, die schöne Göttin Venus anzubeten und den Grazien zu opfern. Er rühmt ihre Artigkeit und ihre Klugheit; er lächelt ihnen freundlich zu; er lobt sie wegen ihrer Sorglosigkeit in Beziehung auf Gott und den Teufel, und weil sie nur noch dunkle Erinnerungen an diese beiden Personen hätten, welche noch in dem Volksglauben Deutschlands lebten. Ich weiß sehr wol, daß ein Diplomat einnehmend sein muß; er muß es aber stets mit Würde sein; doch solche Fuchsschwänzerei ist eines Glaubensboten der Vorsehung nicht würdig; sie sind noch weniger der Nation würdig, an welche sie gerichtet und welche Kraft genug hat, um Schmeicheleien entbehren zu können. Für jeden Ehrenmann giebt es nur eine einzige Art, die Gastfreundschaft, welche eine fremde Nation ihm gewährt, zu vergelten, die, sich ihrer würdig zu zeigen. Übrigens muß er zuweilen den Mut haben, seinen Gastfreunden nicht zu gefallen und lieber ihren Beifall zu verdienen als zu erhalten.
Es war für uns patriotische Schriftsteller wahrlich sehr leicht, unsern Grundsätzen treu zu bleiben, als wir noch in Deutschland waren. In unserm Vaterlande hatten wir mit keiner Verführung zu kämpfen, weder mit der Verführung der schönen Welt, welche noch nicht daselbst geschaffen, noch mit der der großen Welt, welche dort uns verachtet, uns niemals in ihre himmlische Sphäre eintreten läßt, unser Verlangen, ihr zu gefallen, nicht in Anschlag bringt, und die, indem sie sich am allerwenigsten um unsre Meinungen kümmert, uns nicht durch Liebkosungen oder durch wesentlichere Mittel zu gewinnen sucht. In Deutschland haben sie nicht jene constitutionellen Arzneimittel nöthig: sie haben die Censur, um unserer Unverschwiegenheit zuvorzukommen, und die Kerker, um sie zu unterdrücken. Paris hat seinen Markt der Unschuldigen; Wien, Berlin, München wissen seiner zu entbehren; dort unten kauft man nicht die Unschuld, man ergreift sie, das arme Thier, und sie stellt in den Pfandstall.
Doch in Frankreich ändert sich unsre Lage und wird zugleich angenehmer und gefährlicher. In diesem Lande gelten die Gelehrten etwas, und der ganze Geist des Herrn Heine reicht nicht hin, um die Aufmerksamkeit einer Gesellschaft, selbst in Gegenwart eines deutschen Diplomaten, zu erlangen. In diesem Lande hat die materielle Macht keine Gewalt ohne Verbindung mit der moralischen Macht, und das Laster selbst muß sich um den Schutz der Tugend bewerben. Hier können wir die Beständigkeit unsrer Meinungen und unsern Muth, sie zu vertheidigen, zeigen; hier können wir beweisen, daß wir nicht aus persönlichem Interesse für die Freiheit gekämpft hatten. Unschuldig und ohne Erfahrung in den Strudel von Paris geworfen, dieser liebenswürdigen und gottlosen Stadt, dem Paradies der Teufel und der Hölle der Engel, wo man so weit gekommen, alle Fäulniß geruchlos zu machen, müssen wir hier nach Ruhm streben, damit unser Vaterland den Verlust unseres Beistandes unter die Zahl seiner Unglücksfälle rechne.
Nachdem wir in ein fremdes Land verwiesen, wird unsre Muttersprache, die uns dahin begleitet, selbst als verwiesen, als geflüchtet angesehen und wie unsre Personen unter Aufsicht aller Polizeibehörden des Continents gestellt. Uns ist verboten zu handeln, ihr ist verboten zu sprechen, sogar von fern, gegen die Despoten Deutschlands. Nun aber der Willkür der französischen Sprache überlassen, jener seit zwei Jahrhunderten von den Königen, Diplomaten und Aristokraten von ganz Europa gemodelten und verdorbenen Sprache; jener gefährlichen Sprache, welche vielzüngig ist für die Lüge und stammelnd für die Wahrheit, müssen wir wachen, auf daß die Leichtigkeit zu täuschen in uns niemals die Lust errege, zu täuschen.
Im Dienste der Wahrheit genügt es nicht, Geist zu zeigen, man muß auch Mut zeigen. Es ist nicht genug, dem Frankfurter Bundestag einige boshafte Redensarten an den Kopf zu werfen und von Zeit zu Zeit einen Strauß mit einem schönen Glückwunsch für Deutschlands Freiheit zu überreichen; nur an diesen kleinen Ergötzlichkeiten erfreut sich die rhetorische Eitelkeit eines Schriftstellers, sie ergötzen aber nicht unsre unglücklichen unter den Bleidächern der deutschen Inquisition seufzenden Landsleute und können ihrer Sache nicht förderlich sein. Noch in der Verbannung können wir für unser Vaterland kämpfen, indem wir das Princip des Bösen bekämpfen, welches durch die ganze Welt dasselbe ist, obgleich mehr oder minder verhüllt, je nach den Hindernissen, welche die Sitten und die Staats-Einrichtungen ihm entgegensetzten. Dies böse Princip ist die Aristokratie, die Vereinigung des Egoismus. Wir dürfen uns nicht diesen Aristokratieen fügen, wir dürfen nicht in Frankreich liebkosen, was wir in Deutschland zurückgewiesen haben. Wahrlich, es wäre nicht der Mühe wert, daß wir uns durch die Kühnheit unsrer Meinungen und die Strenge unsres Liberalismus aus unserm Vaterlande hätten verbannen lassen, um nachher in einem fremden Lande heimisch zu werden, dort den Gefälligen gegen die vornehme Welt zu spielen und unsre Bärenhaut mit einer Fuchshaut zu vertauschen. Das wöge nicht die Reisekosten, das wöge nicht die Mühe auf, die es uns kostet, unsre inländischen Gedanken und Gesinnungen in dem warmen Treibhause einer fremden Sprache zu pflegen; das wöge nicht unsre Verlegenheit auf, wenn wir die Comptoirdamen der Lesekabinette und die reizenden Bewohnerinnen am Durchgang zum Panorama über unsre naiven Germanismen lächeln sähen.
Der gewandtesten, schlausten, katzenartigsten Kritik würde es dennoch nie gelingen, Herrn Heine zu ertappen, der noch mehr Maus als die Kritik Katze ist. Er hat sich in allen Winkeln der moralischen, geistigen, religiösen und socialen Welt Löcher aufgespart, und alle diese Löcher haben unterirdische Verbindungsgänge unter einander. Ihr sehet Herrn Heine aus einer von diesen kleinen Meinungen heraustreten, ihr verjagt ihn, er begiebt sich dahin zurück: ihr umzingelt ihn; ihr werdet selbst ertappt, siehe, da entwischt er aus einer ganz entgegengesetzten Meinung. Ergebet euch, ihr verliert eure Mühe und eure List. Ihr leset die oder die Seite von Herrn Heine, wo ihr eine falsche, abgeschmackte, lächerliche Behauptung findet; beeilet euch nicht, sie zu widerlegen, wendet das Blatt um, Herr Heine hat umgewendet und widerlegt sich selbst. Wenn ihr solche schillernde Geister nicht zu schätzen wißt, um so schlimmer für euch, ihr seid nicht auf der Höhe der rhetorischen Küche; es giebt nichts Köstlicheres, als diesen Mischmasch von Meinungen.
Wie gesagt, ich wage nicht, mit der großen filosofischen Gelehrsamkeit des Herrn Heine zu streiten, welche die Unterstützung der Vorsehung noch furchtbarer macht. Aus diesem Grunde werde ich nicht untersuchen ob die Darlegung der verschiedenen Sisteme deutscher Filosofie, die Herr Heine für den Gebrauch des Foyer der Oper gemacht, wahr oder falsch ist; doch ich kann nicht umhin, die geschmackvolle und angenehme Art zu beurtheilen, womit Herr Heine die schwierigsten Gegenstände behandelt. Dieser liebenswürdige Schriftsteller spricht von Liebe, wenn er gerade von Kant redet, von Weiberhemden, wenn er vom Christenthum, und von sich selbst, wenn er von Allem spricht. Was mich betrifft, so gefallen sie mir wenig, diese Rosen- und Veilchengehänge, womit Herr Heine gefallsüchtig genug ist, die derben und nahrhaften Gerichte der deutschen Wissenschaft zu schmücken. Dieser Durchschlag von Literatur, diese Crême von Filosofie, diese Beafsteek’s mit Vanille sind nicht nach meinem Geschmack.
Die Franzosen dürfen diesem Gelehrten keinen großen Dank wissen für die Anstrengungen, die er zu ihren Gunsten macht, um die Schwierigkeiten, welche dem Verständniß der deutschen Literatur vorangehen, zu heben. Indem er die Hindernisse des Weges entfernt, entfernt er das Ziel, denn nur in der Bemühung selbst findet sich der Lohn der Bemühung. Man dringt nicht in das deutsche Leben mit wenig Kosten ein. Die Deutschen selbst, die gebornen Deutschen, erfüllen nur unter vielen Beschwerden die Bestimmung ihrer Nationalität und gelangen erst nach großen Leiden zu jener Tiefe des Geistes, welche den Gefühlen den Frieden und die Sicherheit des Grabes giebt, und zu jener Glückseligkeit des Geistes, welche sie über ihren unseligen socialen Zustand tröstet. Das deutsche Leben gleicht einer hohen Alpengegend: es ist groß, königlich, die Krone der Erde, die mit ihren ewigen Gletschern schimmert! Deutschland ward das reinste Sonnenlicht, den andern Ländern die Wärme der Sonne. Seine unfruchtbaren Höhen haben die Welt zu ihren Füßen befruchtet. Dort sind die Quellen der großen Ströme der Geschichte, der großen Nationen und der großen Gedanken. Den Deutschen das Genie, den Franzosen das Talent; den einen die schöpferische, den andern die anwendende Kraft. Aus dem deutschen Boden sind alle jene großen Ideen hervorgegangen, die von geschickteren, unternehmendern oder glücklichern Völkern in’s Werk gesetzt und benutzt worden sind. Deutschland ist die Quelle aller europäischen Revolutionen, die Mutter jener Entdeckungen, welche die Gestalt der Welt verändert. Das Schießpulver, die Buchdruckerei, die Reformation sind aus ihrem Schoose hervorgegangen – undankbare und vermaledeite Töchter, welche Fürsten geheirathet und ihre plebejische Mutter verhöhnt haben.
Um diesen erhabenen Anschauungspunkt des deutschen Lebens zu gewinnen, dürft ihr euch nicht in einer weichen, wohlverschlossenen Sänfte tragen lassen, denn dann wäre dies euer in Bewegung gesetztes Schlafzimmer, und ihr werdet nie aus eurer Lebensgegend heraustreten. Man muß die Beschwerden nicht scheuen, man muß nicht müde werden, man muß sich gegen Kälte, Hitze und Schwindel abhärten. Man muß steigen, klettern, springen, sich durch den Schnee einen Weg bahnen können. Doch seid versichert, daß der Lohn euern Bemühungen nicht fehlen wird, denn dort oben findet sich das geistige Leben der Deutschen.
Die Franzosen klagen oft und spotten zuweilen über den Nebel, welcher den Geist der Deutschen umhüllt. Aber diese Wolken, welche die Franzosen am Sehen hindern, sind nur zu den Füßen der Deutschen gelagert; sie selbst ragen mit ihrer ganzen Größe über die Wolken hinaus und athmen unter einem blauen Himmel eine reine und strahlende Luft. Doch der Tag nahet, noch einige Stunden der Geschichte, und es zerstreuen sich die Nebel, welche zwei Nationen trennen. Alsdann werden wir zur Erkenntniß kommen; die Franzosen steigen herauf, die Deutschen herab, um sich die tintenfleckigen Hände zu reichen, und dann werden sie ihre Federn in die roten Hände ihrer Könige legen, um damit an den Ufern des Missouri das letzte Kapitel ihrer Regierung zu schreiben.
Die Religion dient Herrn Heine als Schaukel und das Christentum als Schaukelpferd. Er liebkost es, er schilt es, er peitscht es, er stößt es mit seinen Fersen; zwar kommt er nie vorwärts, aber will Herr Heine jemals vorwärts kommen? Er will nur sich schaukeln und sich Bewegung verschaffen. Beleidigt Herrn Heine nicht, indem ihr ihn eines ernsten Strebens, eines Glaubens, einer Überzeugung für fähig haltet; Herr Heine weiß so gut als Einer, daß nichts fürchten, nichts hoffen, nichts lieben, nichts verehren und kein Princip haben, die wesentlichsten Züge eines großen Charakters sind.
Doch zum Unglück für die Unerschütterlichkeit des Geistes von Herrn Heine hat ihn der Direktor des Theaters dramatischer Narrheiten, das wir »Welt« nennen, zu allen ersten Rollen bestimmt, ohne selbst eine doppelte ihm zu geben. Das Repertorium des Herrn Heine ist unermeßlich; hundert gewöhnliche Schauspieler des Königs würden dabei nicht zureichen. Er spielt den Antichrist, während Voltaire, jener große Schriftsteller, nur den St. Johann Baptista, den Vorboten des Antichrist, gespielt. »Voltaire,« sagt Herr Heine, »hat nur den Leib des Christenthums verletzen können.« Doch ihm selbst, dem armen Manne, ist das mühsame Geschäft zugefallen, das innere Wesen des Christenthums zu vernichten.
»Die Hauptidee des Christenthums,« sagt ferner Herr Heine, »ist die Vernichtung der Sinnlichkeit.« Aber was ihn betrifft, er hat von der Vorsehung den Auftrag erhalten, die Rechte des Fleisches in Anspruch zu nehmen. Danken wir der Vorsehung, daß sie, und ganz ausdrücklich für Herrn Heine, eine neue Rechtsprofessur eingerichtet für die Lehre über die Rechte des Fleisches!
Doch nicht allein die Rechte des Fleisches nimmt Herr Heine in Anspruch, er spricht auch für die Wiedereinsetzung aller Materie. Hier ist ein Stück von seiner herrlichen Vertheidigungsrede:
»Kant hat den Himmel gestürmt und die ganze Besatzung über die Klinge springen lassen. Ihr sehet die Leibwachen Gottes leblos hingestreckt; er selbst schwimmt in seinem Blute; es giebt jetzt keine Allbarmherzigkeit mehr, keine Vatergüte, keine jenseitige Belohnung für diesseitige Enthaltsamkeit, die Unsterblichkeit der Seele liegt in den letzten Zügen – das röchelt, das stöhnt.
Die Menschheit lechzt nach nahrhafterer Speise als nach Christi Blut und Fleisch. Die Menschheit lächelt mitleidig über ihre Jugendideale …, und sie wird männlich praktisch. Die Menschheit huldigt jetzt dem irdischen Nützlichkeitssystem …, und dann müssen der Materie noch große Sühnopfer geschlachtet werden, damit sie die alten Beleidigungen verzeihe. Es wäre sogar rathsam, wenn wir Festspiele anordneten und der Materie noch mehr außerordentliche Entschädigungsehren erwiesen. Denn das Christenthum, unfähig die Materie zu vernichten, hat sie überall fletrirt, es hat die edelsten Genüsse herabgewürdigt, und die Sinne mußten heucheln, und es entstand Lüge und Sünde. Wir müssen unseren Weibern neue Hemden und neue Gedanken anziehen, und alle unsere Gefühle müssen wir durchräuchern, wie nach einer überstandenen Pest.«
Also geschehe es, und mögen die Wäscherinnen und die Parfümeriehändler sich darüber freuen! So ist denn Herr Heine von der Vorsehung zum Anwalt der Materie, zum Vormund der minderjährigen Materie ernannt. Doch mag er auf seine Mündel Acht haben! Über Nacht kommt guter Rat für die Töchter, und wenn 35 Jahre vorbei, ist es besser Spiritualist zu sein als Bewahrer der Materie.
Zu einem gewissenhaften Manne, der sich nur beim Suchen der Wahrheit verirrt, würde ich sagen: Nein, das Christenthum hat die Menschen nicht unglücklich gemacht, es hat sie seit seinem Erscheinen so gefunden und sie in ihrem Elend getröstet und unterstützt. Das Christenthum ist der Arzt der römischen Welt gewesen, als sie durch ihre ungezügelten Leidenschaften und ihre viehischen Ausschweifungen krank geworden. Herren und Sclaven waren damals gleich schuldig; die Einen schwammen im Blute, die Andern waren im Kote der Knechtschaft versunken; das Christenthum reinigte die Einen und half den Andern wieder auf. Es schrieb Allen eine heilsame Diät für Seele und Körper vor, und diese strenge Diät hat der Welt das Leben gerettet und sie geheilt. Das Christenthum hat die Rechte des Fleisches abgeschafft, es hat niemals das Opfer der sinnlichen Genüsse verlangt, es hat sie nur der Vormundschaft der Seele unterworfen, um sie reiner und dauerhafter zu machen. Keine Religion hatte jemals so viel Nachsicht für die menschlichen Schwächen, als die christliche.
Der Katholicismus, weit entfernt die Völker entnervt zu haben, hat ihnen die Stärke und die Energie wieder gegeben, die sie unter der römischen Herrschaft verloren hatten, und welche die neuern Völker, die sich vom Katholicismus losgerissen, zum zweiten Male verloren haben. Das einzige nordische Volk, welches seit drei Jahrhunderten nicht einen einzigen Tag aufgehört sich für die Freiheit zu regen, ist das polnische, das katholisch geblieben. Der Katholicismus ist kein »düsterer, abgehärmter« Cultus, wie Herr Heine sagt; er ist die heiterste, lustigste Religion, die je bestanden. Nein, die Sinne sind nicht vom Christenthum zur Heuchelei getrieben worden, diese Religion verlangt nur einen Schleier für die Sinnengenüsse, sie fordert nur Scham. Die Scham ist die einzige Gottheit, welche selbst die verdorbensten Menschen nie zu verläugnen wagen, und über ihren Cultus macht sich Herr Heine als über einen Aberglauben lustig und nennt ihn Sinnenheuchelei. Ich weiß wohl, daß dies nicht sein innerer und aufrichtiger Gedanke ist; doch dahin kann ein ehrbarer und feiner Mann wie Herr Heine, der sich rühmt nie geraucht, nie Sauerkraut gegessen zu haben und der in diese Eigenschaften seine besten Ansprüche auf Frankreichs Achtung setzt, dahin kann er durch eine unselige Phrasenliebhaberei gebracht werden. Herr Heine hat tausendmal die Liebe gefeiert; er hat sie in Versen besungen, er hat sie in Prosa angerufen; er muß es besser als irgend Jemand wissen, daß das Geheimniß der Gott der Liebe und daß die Scham ihre Religion.
Ist es denn so schwer ein Christ zu sein? Zum wenigsten ist es nicht so kostspielig als Herr Heine denkt. Jeder wer liebt, ist Christ. Und jeder Mensch muß, selbst aus Eigenliebe, etwas lieben und anbeten, was nicht er selbst ist. Es ist ein wohleingerichteter Egoismus, einen Theil seines Vermögens in dem Ganzen, welches nicht gestohlen werden kann, niederzulegen und seine Seele der Ewigkeit anzuvertrauen, die stets zahlungsfähig ist. Der Eine betet die Ehre an, ein Anderer den Ruhm, noch ein Anderer die Tugend, oder die Tapferkeit, oder die Treue, oder die Freiheit, oder die Wahrheit, oder die Liebe oder die Freundschaft. Je nun! das Christenthum ist das Pantheon aller dieser Gottheiten. Tretet ein in den Tempel, knieet nieder vor der Ehre oder vor der Freiheit, so betet ihr denselben Gott an, ihr seid Christen.
Man ist ohne Glauben niemals glücklich, man lebt von seiner Tagearbeit und beunruhigt sich über den nächsten Tag. Der Glaubende wird von der mütterlichen Sorgfalt der Vorsehung gepflegt; der Nichtglaubende ist ein Bettler, der von den Almosen des Glückes lebt. Der Glaube ist die Wurzel der Wissenschaft; getrennt von ihm ist das Wissen nur ein Stück Holz, das weder Blüte noch Frucht trägt. Ohne Glauben hat man kein Herz, und die großen Gedanken, die lebendig machenden Gedanken kommen aus dem Herzen. Man kann wol ohne Herz Talente haben, doch das sind nur eingemachte Früchte, welche den Durst nicht stillen. Man kann wol Geist ohne Herz haben, doch das ist nur plattirter Geist, der dem Ungemach der Witterung nicht widersteht und beim geringsten Reiben der Kritik sich rötet.
Der Protestantismus, sagt Herr Heine, war für mich mehr als eine Religion, er war eine Sendung; und seit vierzehn Jahren kämpfe ich für seine Interessen gegen die Ränke der deutschen Jesuiten. Vierzehn Jahre, das ist zweimal der siebenjährige Krieg, der einen großen König verewigt hat. Herr Heine muß müde sein von seinem Ruhme, möchte er seinen Hubertusburger Frieden mit den Jesuiten schließen! Da ist also eine neue Sendung auf Herrn Heine’s Schultern; wahrlich, es ist ein schwerer Frohndienst, der Günstling der Vorsehung zu sein, und ein Anderer könnte nicht dabei bleiben. Herr Heine steht, von seiner Geburt an, an der Spitze der Bewegungen Deutschlands; er ist der Regimentstambour des Liberalismus, der Pathe der neuen literarischen Schulen, denen er seinen Namen giebt, der Beschützer des Protestantismus, der Schrecken der Republikaner, der Aristokraten und der Jesuiten. Er hat Alles vorhergesehen, Alles vorhergesagt, Alles geleitet; zuerst unter allen Deutschen hat er dies gesagt, hat er jenes vollbracht. Herr Heine würde gern ein Patent für Erfindung der Welt verlangen, wenn nicht unglücklicherweise die heilige Schrift da wäre mit unbestreitbaren Beweisen, daß die Welt vor Herrn Heine’s Geburt erschaffen.
Aber was giebt Herrn Heine diesen Dünkel? Er erklärt es uns selbst. »Wagen,« sagt er, »ist das Geheimniß des Gelingens in der Literatur, wie in der Liebe.« In der Liebe ist es unglücklicherweise wahr, und unschuldige, unerfahrene Frauen werden oft für ein edles Zutrauen betrogen. Es ist sehr wahr, daß sie dafür nur ein einziges Mal betrogen werden, doch das bessert die Wagenden nicht, welche, sich auf die weibliche Verschwiegenheit der Beleidigten verlassend, die Geliebten wechseln und stets von Neuem wagen; doch wie kann die Kühnheit in der Literatur die Kraft ersetzen? Das läßt sich schwer begreifen.
Herr Heine bringt in Alles Liebe, in die Wissen schaft, Literatur, Politik, Filosofie, Theologie, Freundschaft. Es wäre nichts daran auszusetzen, wenn es mit Maß geschähe; doch Herr Heine hält kein Maß. Wir erinnern ihn an jene weise Lehre, die ein berühmter Koch seinen Zöglingen gab: »Vor Allem, meine Freunde, bedient euch niemals des Pfeffers bis zum Fanatismus.«
Ebenso wie in der Politik ist Herr Heine in immerwährendem Übergang begriffen zwischen den entgegengesetzten Meinungen, indem er auf dem Schlachtfelde, das sie trennt, hierhin und dorthin läuft, sich bald der einen, bald der andern nähert; ebenso ist er in Sachen der Religion in immerwährendem Übergang begriffen zwischen dem Deismus und Atheismus. Der Grund liegt darin, Herr Heine ist nur ein Phrasenlieferant, der Jedermann mit der kaufmännischsten Unparteilichkeit davon anbietet. Er künmert sich nie um das Recht, die Gerechtigkeit einer Sache; er sorgt nur für seinen Worthandel, und kaum hat ihn die Hoffnung zu gewinnen zu einer Partei hingezogen, so treibt ihn alsbald die Furcht zu verlieren zu der andern Partei zurück. Bald würdigt er das Christenthum herab, bald preist er es; je nachdem ihm das Eine oder das Andere eine günstige Gelegenheit darbietet, seine gestickten Phrasen vortheilhaft anzubringen; denn Himmel und Erde dienen Herrn Heine nur als Cannevas, um darauf seine hübschen kleinen Nadelarbeiten darzustellen, welche von vorn betrachtet sehr gefallen, welche aber ihre Schönheit und ihren Wert verlieren, sobald man sie umwendet.
Herr Heine würde herzlich lachen, wenn ich auf den Gedanken käme, ihm seinen Unglauben vorzuwerfen; aber er wird meinen frommen Ermahnungen die ernsthafteste Aufmerksamkeit schenken, wenn ich ihn wahrnehmen lasse, daß die Gottlosigkeit eine veraltete Mode sei, daß kein Verdienst mehr darin liege, den religiösen Aberglauben zu bekämpfen, seit man für solche Kühnheiten nicht mehr verhaftet werde und man keine gottlosen Bücher mehr verbrenne; daß die Holbachs und die Lamettrie’s des neunzehnten Jahrhunderts nur die Don Quichotte’s des Atheismus seien; daß die Pariser, wie sie sein müssen, sich nicht mehr des alten Wahlspruches von Voltaire bedienen: »Zermalmt den Ehrlosen,« sondern daß sie den neuen Wahlspruch angenommen: »Zermalmt das Gesindel;« kurz, daß alle Schmähschriften gegen das Christenthum ungeheuer Rococo wären.
Herr Heine behauptet, das achtzehnte Jahrhundert habe den Katholicismus in Frankreich so vollkommen zermalmt, daß es ihn fast ohne Lebenszeichen gelassen. Das ist ein Irrthum, den dieser Schriftsteller mit vielen Andern theilt. Was uns betrifft, so denken wir im Gegentheil, das achtzehnte Jahrhundert, weit entfernt den Katholicismus zermalmt zu haben, habe ihn vielmehr vor seinem Untergang bewahrt. Voltaire und seine Schüler haben die Religion abgeraupt. Überdies kommt wenig darauf an, worauf jene Filosofen abgezielt haben; man muß sehen, was sie mit ihren Bemühungen erreicht haben. Wenn die Vorsehung (Herr Heine wird mir das Plagiat verzeihen) irgend eine Absicht hat, so bedient sie sich stets der Menschen, welche die Gegner ihrer Absichten sind; das ist der kürzeste Weg, um ans Ziel zu gelangen. Die Könige sind es, welche die Republiken gründen, die Ungläubigen, welche die Religion wiederherstellen. Ebenso wie die französische Revolution nicht beabsichtigte, die politische Gesellschaft umzustürzen und die Herrschaft des Gesetzes, wie ihre Gegner behaupten, zu vernichten, sondern keinen andern Zweck hatte als dem Staate eine bessere Verfassung zu geben; ebenso hat auch die scheinbar antireligiöse Bewegung des achtzehnten Jahrhunderts nur versucht, die Verfassung der Kirche aus einer monarchischen, die sie ist, in eine volksthümliche zu verwandeln. Sobald es keinen Pabst, keine Büdget-fressenden Bischöfe, keine stehenden Mönchsheere, keine schwarze Gendarmerie mehr geben wird, sobald das Volk selbst seine geistigen Verwalter wählt, und die Kirche für und durch das Volk regiert wird, erhält der Katholicismus seinen Glanz und seine ursprüngliche Kraft wieder.
Die politischen und religiösen Bestrebungen des Jahrhunderts gehen Hand in Hand, und nur mit einander und zu gleicher Zeit werden sie ihr Ziel erreichen. Die Völker müssen, um frei zu sein, religiös sein; die freiesten Völker, die Schweizer, die Engländer, die Nordamerikaner sind die religiösesten Völker. Ihre Religiosität ist ihrer Freiheit nicht nachgefolgt, sondern vorangegangen; man muß Gott fürchten, um nicht die Menschen zu fürchten.
Wenn man Herrn Heine über die Jesuiten Deutschlands jämmerlich klagen hört, sollte man glauben, daß sie das Land beherrschen; aber dem ist nicht so. Es ist wol wahr, daß in Deutschland wie überall, wo es einen Krieg giebt zwischen dem Despotismus und der Freiheit, die Jesuiten bei jedem Kampfe herbeiströmen, so wie die Raben, welche die Leichname wittern, über den Schlachtfeldern fliegen: aber diese Raben, welche die Leichname beider Heere unparteiisch fressen, bringen nicht den Sieg zur Entscheidung. Die monarchischen Jesuiten werden uns nichts Übles zufügen, sie sind zu verschmitzt, um nicht das nahe Ende der Könige zu bemerken: vor den Volksjesuiten müssen wir uns jetzt hüten. Ich werde dem Schrecken des Herrn Heine gern einräumen, daß zu München die Jesuiten großen Einfluß besitzen; aber nur weil der König von Baiern selbst Jesuit ist, und seine Diener und Schmeichler, wie das immer geschieht, die Livree ihres Herrn tragen.
Man darf sich nicht allzusehr über diesen guten König beklagen, daß er Jesuit geworden; er hat sich den Mönchen und Heiligen erst in die Arme geworfen, seit ihn die Götter des Olymps verraten und auf die grausamste Art gefoppt haben. Gleich anfangs begeisterte Apollo diesen guten König von Baiern zu so abscheulichen Versen, daß man sie nicht laut vorlesen kann, ohne alle Hunde zwei Meilen in der Runde bellen zu hören; dann Venus, dann Merkur; kurz, das waren Stückchen, um den sanftesten Menschen in Wut zu versetzen. Auch hat davon der gute König von Baiern den Kopf verloren, ohne die übrigen Verluste zu rechnen; und seit dieser Zeit weiß er nicht mehr, was er thut, noch was er will, noch was er kann. In diesem unglücklichen Seelen- und Körperzustande hat er die rechtschaffensten Leute seines Königreichs verhaften lassen und hält sie seit zwei oder drei Jahren in fürchterlichen Kerkern, ohne öffentliche Anklage und ohne richterliches Urtheil. Dieser gute König hat bis an die fünfzig Klöster in seinem kleinen Königreiche eingerichtet, und er vermehrt sie noch täglich. Die baiersche Regierung ist eines der Meisterstücke der Politik des Herrn von Metternich. Dieser gewandte Staatsmann hat den König von Baiern überredet, daß er auf seinem eignen Gebiete und auf eigne Kosten eine von Klöstern gedeckte und von Kapuzinern bewachte chinesische Mauer aufführen ließ, um die Grenzen Österreichs gegen den Eindrang der Aufklärung von Seiten des südlichen Deutschlands zu schützen. Es ist derselbe König von Baiern, den Herr Heine genannt hat »einen der edelsten und geistreichsten Fürsten, die je einen Thron geziert,« und dann läßt er sich, um von seinen pindarischen Anstrengungen auszuruhen, mit seiner ganzen Schwere auf die niederen Jesuiten fallen und verursacht ihnen bedeutende Quetschungen. Aber geht alles Dies uns an? Es ist eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen Herrn Heine und den Jesuiten, womit das Heil des deutschen Volkes nichts zu schaffen hat; mögen sie ihren Streit schlichten wie sie können. Herr Heine beklagt sich darüber, daß ihn die Jesuiten in München gequält und bis Paris verfolgt haben; daß sie dort wie Schlangen um ihn zischen und daß ihn eine dieser Jesuitenschlangen in die Ferse gebissen, als er gerade auf dem Boulevard Montmartre spazieren ging. Herr Heine sagt nicht genau dieses; er spricht nur davon im Allgemeinen; er sagt, man könnte auf dem Boulevard Montmartre lustig spazieren gehen und unvermutet den Biß eines Jesuiten in der Ferse fühlen. Aber wie die Besorgnisse von Herrn Heine stets geschichtlich sind, so ist er ohne Zweifel selbst von einem Jesuiten gebissen worden.
Möge Herr Heine Muth fassen und obwol ich die Jesuiten nicht mehr hasse, seit ihr Ehrgeiz so weit ab genommen, daß sie sich mit der Verfolgung eines unschuldigen Gelehrten begnügen, so würde ich mich dennoch freuen, wenn Herr Heine auch aus diesem letzten Kampfe als Sieger hervorginge. Vor noch nicht zwei Jahren hat er über die grausamen Verfolgungen geklagt, die er von Seiten der wider ihn verbündeten Aristokraten und Republikaner zu erdulden gehabt. In seinem letzten Werk spricht Herr Heine weder von den Aristokraten noch von den Republikanern mehr, ein sicherer Beweis, daß er sie vernichtet. Wohlan! er wird auch die Jesuiten zermalmen, und vielleicht ist der Tag nicht fern, wo Herr Heine in aller Ruhe und Sicherheit auf dem Boulevard Montmartre spazieren gehen kann, ohne den Biß eines kleinen baier’schen Loyola fürchten zu müssen.
Wir sind niemals zufriedener mit Herrn Heine, als wenn er sich im Irrthum befindet, doch unglücklicherweise ist dieser Fall sehr selten. Herr Heine ist selten im Irrthum, weil er selten die Wahrheit sucht. Er ist eben so unbesorgt, sich von ihr zu entfernen, als sich ihr zu nähern; sie zu finden, als sie zu verfehlen. Herr Heine sucht nur den möglich schönsten Ausdruck; das Auszudrückende ist ihm gleichgültig. Aber möge er es offen bekennen, möge er es ein für alle Mal erklären, daß er beim Schreiben nie einen andern Zweck habe, als ein Wörterbuch schöner und guter Redensarten in Lieferungen von zwei Bänden herauszugeben, und alsdann werden wir ihm nichts mehr vorzuwerfen haben. Wir werden es ganz einfach finden, daß Herr Heine das Ja in den Buchstaben J und das Nein in den Buchstaben N setzt, und daß Gott niedriger steht als der Teufel; kurz, wir würden Herrn Heine willig zugeben, daß Kleider Leute machen.
Hier noch einige aus dem Werke des Herrn Heine ausgezogene Stellen, um es Jedermann handgreiflich zu machen, auf welche Art dieser Schriftsteller spielt, nicht mit Worten, die ihm heilig sind, sondern mit Sachen. Er ist oft so ungeduldig und eilig, sich selbst zu widersprechen und seinen ursprünglichen Gedanken für ungültig zu erklären, daß er sich nicht die Zeit nimmt, ihn zu vollenden, und indem er sich selbst das Wort abschneidet, sogleich die entgegengesetzte Meinung anführt.
»Die Benthamisten, sagt Herr Heine, die Nützlichkeitsprediger, sind gewaltige Geister, die den rechten Hebel ergriffen, womit man John Bull in Bewegung setzen kann. John Bull ist ein geborner Materialist, und sein Spiritualismus ist meistens eine traditionelle Heuchelei oder doch nur materielle Bornirtheit, sein Fleisch resigniert sich, weil ihm der Geist nicht zu Hülfe kommt.« Möge der Geist des Herrn Heine dem Fleische John Bull’s zu Hülfe kommen; möge er, um ihm Herz und Geist zu bilden, eiligst seinen Cursus über die Rechte des Fleisches eröffnen; aber möge er John Bull nicht widersprechende Fehler zur Last legen; das Alibi ist da, um ihn wegen des einen oder andern Vergehens zu rechtfertigen. Wenn John Bull Materialist ist, so kann er nicht zugleich Spiritualist sein, und wenn er aus Heuchelei Spiritualist, so ist er es nicht aus Dummheit. Wenn Herr Heine einen Galimatias machen will, so bringe er ihn wenigstens unter alfabetische Ordnung, wie wir weiter oben gesagt.
Und sehet da den elenden Aristokratismus von Herrn Heine; sehet nur, wie er den redlichen John Bull verachtet. Er, der erste Liebhaber, Anbeter, Vormund, Beschützer und Professor der Materie wird ihrer überdrüssig, sobald er bemerkt, daß das Volk sich ebenfalls um den Materialismus kümmert. Welch fürchterlicher Umsturz der öffentlichen Ordnung! Jakob Gutmann will Wähler und Materialist sein! Man könnte es dabei nicht aushalten, es ist allzu stark! Wahrlich, in unsern Tagen muß man auf Alles gefaßt sein; wir werden noch die Zeiten sehen, wo der Pöbel auf den roten Teppichen der Gänge des italienischen Theaters seine Schuhe abstreicht und am Tage nach einer Vorstellung ganz treuherzig seinen Theil an den geheimen Geldern der Vorsehung verlangt! O Zeiten! o Sitten!
An einer andern Stelle sagt Herr Heine: »Wie man zu Wittenberg in lateinischer Prosa protestirte, so protestirte man zu Rom in Stein, Farbe und Ottaverime. Oder bilden die marmornen Kraftgestalten des Angelo, die lachenden Nymfengesichter des Giulio Romano und die lebenstrunkene Heiterkeit in den Versen des Meisters Ludovico Ariosto nicht einen protestirenden Gegensatz zu dem altdüstern, abgehärmten Katholicismus?« Das ist ein Urtheil, welches die verhärtetsten, unerschrockensten Sofisten zum Erbleichen bringen könnte. Aus gleichen Gründen kann man das Weiße schwarz nennen, indem man seine Weiße als eine Protestation gegen seine Schwärze ansehen läßt; man kann einen redlichen Mann einen Schurken nennen, indem man seine Rechtlichkeit als eine Protestation gegen seine Unredlichkeit bezeichnet! Und wollt ihr das Geheimniß dieser Widersprüche wissen? Herr Heine hatte einige wohlklingende Worte in der Spitze seiner Feder und konnte es nicht über sich gewinnen, sie für eine bessere Gelegenheit aufzusparen.
Wenn Herr Heine zu seinem seltenen Redetalente noch hinzuzufügen wagte das Talent, seiner Unabhängigkeit Achtung zu erwerben, Meinungen, Gesinnungen, Gedanken für sich zu haben; irgend eine Überzeugung zu haben, aber eine feste, unerschütterliche Überzeugung, welche den herrischen Launen der Winde, sowie den gefährlicheren Scherzen der Zefire Widerstand leistete; wenn sich Herr Heine nur um den Beifall der rechtlichen und aufgeklärten Leute und um die Zustimmung seines eigenen Gewissens kümmern und nicht Tag und Nacht bei allen Kaufleuten des Ruhmes herumlaufen wollte, er wäre alsdann ein vollkommener Schriftsteller.
***
Was sich seit Heinrich Heines Das Buch Le Grand und dem Essay Die deutsche Literatur im Rheinland verändert hat, lesen sie in: Lokalhelden, Roman von A. J. Weigoni, Edition Das Labor, Mülheim 2018 – Limitierte und handsignierte Ausgabe des Buches als Hardcover.
Weiterführend → Lesen Sie auch KUNOs Hommage an die Gattung des Essays.