Jedes Licht wirft einen Schatten. Wo Schatten ist, da muss auch Licht sein. Der Schatten ist geheimnisvoll, und das Licht ist Klarheit. Schatten verbirgt, Licht enthüllt. (Das ist die ganze Kunst – zu wissen, was man enthüllt und was man verbirgt, in welchem Masse und wie man das tut).
Josef von Sternberg
Der Kritiker Philipp Bovermann bewertet in der Süddeutschen Zeitung Wolfgang M. Schmitt als YouTube-„Reinkarnation“ eines „früheren Großkritiker-Typus“, des „zornigen, stolzen Verteidiger von Kulturwerten“. Seit mehr als zehn Jahren übt sich die Deutsche Coverversion von Slavoj Žižek auf Youtube in „Die Filmanalyse“. Nun sind seine Reden vom Katheder in gebundener Form erschienen. Dieses Buch versammelt über 120 seiner ideologiekritischen Besprechungen. Hier erfahren wir laut Klappentext „unter anderem, warum wir – seiner Ansicht nach – „Forrest Gump“ hassen sollten, warum „Blade Runner“ 2049 besser ist als das legendäre Original, was „Vertigo“ zum besten Film aller Zeiten macht, wieso der allseits beliebte König der Löwen der schlimmste Film der langen Disneygeschichte ist und warum „The Shape of Water“ seine Oscars nicht verdient hat. An welche Kultfilme erinnern wir uns aus gutem Grund und wo wird unser Blick von der rosarot beschlagenen Nostalgiebrille getrübt? Wo treten die Probleme des vielgescholtenen deutschen Kinos besonders schmerzhaft zutage, wo glimmen dennoch Hoffnungsschimmer auf? Steckt in Kinderfilmen wirklich nur harmlose Zerstreuung? Ist das Kino in Zeiten von Serienboom und Streaminganbietern überhaupt noch zu retten? Und was haben Marx, Foucault, und Freud mit all dem zu tun?“
Das ist mitunter so lustig, wie Deutscher Humor seit Heinz Erhard eben zu sein pflegt. Im Gegensatz zum Original jedoch eher zahm, eben Deutsch. Žižeks eigenwilliger Stil, seine populären akademischen Werke, häufige Veröffentlichungen in Zeitschriften und die kritische Assimilation von Hoch- und Popkultur haben dem „Elvis der Kulturtheorie“ internationalen Einfluss, Kontroversen, Kritik und ein beträchtliches Publikum außerhalb der Wissenschaft eingebracht. Der Kulturkapitalismus ist für Žižek die Weiterführung in eine Art virtuellen Hyperkapitalismus, die uns mit den Herrensignifikanten in ihrer reinsten Form konfrontiert: Hier muss die materielle Produktion der Güter immer noch sichergestellt werden, aber verkauft wird v. a. Immaterielles, eine besondere Art der Erfahrung, wodurch sich mit der Zeit auch das Verhältnis zwischen dem Symbol und seinem Sinnbild verkehrt. Betont wird das Eigentum auch auf Zeichen (Marken und Logos). Die postindustriellen Konzerne verwandeln sich eher in Netzwerke mit Teilbetrieben, die sich unabhängig von der Konzernmutter bewähren müssen. Wenn der Konzern die Werbung an ein Marketingunternehmen auslagert, ebenso Buchhaltung und Produktion von einem billigen Standort zum nächsten wandern, so bleibt von der Firma praktisch nichts mehr übrig außer ihr Zeichen, das Logo, der Markenname. Das Zeichen, hinter dem nichts mehr steht, ist das ultimative Zeichen – der Herrensignifikant. Doch die Logik ist nicht selbst der Fetisch; sie verweist als ein allgemeines Problem der Sprache auf den „großen Anderen“, da sie die Lücke zwischen ihm und den Bedeutungsketten (der Sprache) besetzt. Die Erscheinung des Kulturkapitalismus betrifft nur einen Teil der Menschen, und sie ist nicht zu einem universellen Phänomen zu machen.
Was Slavoj Žižek zu einem cleveren Verknüpfungstheoretiker macht, endet bei seinem Adepten Wolfgang M. Schmitt damit, dass er die grossen Theorien als Masturbationsgrundlage für Hollywood-Filme nutzt. Doch Kino ist erheblich mehr. Die Redaktion präsentiert eine subjektive Auswahl:
Der Existentialist Raymond Chandler ist vor Jahren mit der erkenntnistheoretisch brisanten Aussage aufgefallen, nichts sei so leer wie ein leeres Schwimmbecken. Ohne den Altmeister damit zu übertreffen kann man dagegenhalten: noch leerer ist eine leere Kinoleinwand.
 Film und Geist, unser Gedächtnis und das Kino sind durch den Begriff der Projektion miteinander verbunden. Während Vampire, Tod und Teufel auf Erden keine Heimstadt haben, finden sie auf der Leinwand Unterschlupf. Wenn man so will, ein Paradox, das dem Dasein der zu ewiger Wiederholung verdammten Kreatur zugrunde liegt wie den Gesetzen des Kinos. Im Kino, das jeden Körper zur Erscheinung zwingt, ist der unstoffliche Wiedergänger die Idealbesetzung eines medienimmanenten Horrors: Als „Rückkehr der Geister“ hat der Philosoph Jacques Derrida die Kunst des 20. Jahrhunderts beschrieben, die den Körper zum Leinwand–Gespenst werden läßt und die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit verwischt. Illusionismus und Kino sind Geschwister, die sich einst um die besseren Plätze auf den Jahrmärkten und Bühnen der Variétés und Grand-Cafés gestritten haben. Wie sehr sie als Spektakel zusammengehören, zeigt sich am besten am Filmpionier Méliès, der sich vom englischen Zauberkünstler Maskelyne inspirieren ließ und den Einfluß des «Illusionstheaters» nie verleugnete. Das Dunkel, in dem alle Geschöpfe des Kinos erst zu sich – und zum Publikum kommen, ist das Element der Untoten, das Licht ihre Nemesis. Stereotypen prägen die wiederkehrenden Erzählmuster und Bilder, die das Mainstreamkino seit den zwanziger Jahren prägen. Als entscheidender Punkt in der Anerkennung der stereotypen Strukturen der Filmsprache offenbart sich deren kognitiver Wert. Es sind die mit der Stereotypik einhergehenden Verzerrungen und Reduzierungen, die eine verständliche Vermittlung audiovisueller Inhalte ermöglichen. So dienen die durch die Wiederholung sich verflachenden Formulierungen sowohl der Figurenbeschreibung als auch der Skizzierung der Handlungsstränge. Die meisten Regisseure benutzen die Kamera nur, um selbst zu existieren. Sie benutzen sie nicht, um etwas zu sehen, was man ohne Kamera nicht sieht.
Film und Geist, unser Gedächtnis und das Kino sind durch den Begriff der Projektion miteinander verbunden. Während Vampire, Tod und Teufel auf Erden keine Heimstadt haben, finden sie auf der Leinwand Unterschlupf. Wenn man so will, ein Paradox, das dem Dasein der zu ewiger Wiederholung verdammten Kreatur zugrunde liegt wie den Gesetzen des Kinos. Im Kino, das jeden Körper zur Erscheinung zwingt, ist der unstoffliche Wiedergänger die Idealbesetzung eines medienimmanenten Horrors: Als „Rückkehr der Geister“ hat der Philosoph Jacques Derrida die Kunst des 20. Jahrhunderts beschrieben, die den Körper zum Leinwand–Gespenst werden läßt und die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit verwischt. Illusionismus und Kino sind Geschwister, die sich einst um die besseren Plätze auf den Jahrmärkten und Bühnen der Variétés und Grand-Cafés gestritten haben. Wie sehr sie als Spektakel zusammengehören, zeigt sich am besten am Filmpionier Méliès, der sich vom englischen Zauberkünstler Maskelyne inspirieren ließ und den Einfluß des «Illusionstheaters» nie verleugnete. Das Dunkel, in dem alle Geschöpfe des Kinos erst zu sich – und zum Publikum kommen, ist das Element der Untoten, das Licht ihre Nemesis. Stereotypen prägen die wiederkehrenden Erzählmuster und Bilder, die das Mainstreamkino seit den zwanziger Jahren prägen. Als entscheidender Punkt in der Anerkennung der stereotypen Strukturen der Filmsprache offenbart sich deren kognitiver Wert. Es sind die mit der Stereotypik einhergehenden Verzerrungen und Reduzierungen, die eine verständliche Vermittlung audiovisueller Inhalte ermöglichen. So dienen die durch die Wiederholung sich verflachenden Formulierungen sowohl der Figurenbeschreibung als auch der Skizzierung der Handlungsstränge. Die meisten Regisseure benutzen die Kamera nur, um selbst zu existieren. Sie benutzen sie nicht, um etwas zu sehen, was man ohne Kamera nicht sieht.
Das Kino ist ein Schwellenort
Die Intensität der Begegnung ist eine Chance, die das Kino bietet, und dort liegt auch das politische Moment des Kinobesuchs. Das Kino ist ein Schwellenort, an dem ich scheinbar für eine Zeit in einem anderen Leben bin, aber ich bin auch in Gesellschaft und an der Schnittstelle mit diesen anderen – und meinem eigenen – Leben. Das Kino hat genügend Anteile der Aussenwelt. Wenn ich es verlasse, bin ich sofort in der Zone des wirklichen Lebens, des Alltags. Darum ist es ja auch als städtisches Medium so erfolgreich geworden. Natürlich ist das Konzerthaus und das Konzert als Aufführungsmodus ebenfalls ein solches Dispositiv, aber es ist in Bezug auf Habitus und Status ganz anders strukturiert als das Kino. In ihrer ganzen medialen und ökonomischen Entwicklung hat sich die Gesellschaft, z. B. mit Fernsehen oder Internet, von „alltäglich–intensiven“ Begegnungen schlicht entfernt. Ich halte es für einen politischen Akt, diese Intensität öffentlicher Situationen wieder zu betonen.
Der Unterschied zwischen Suspense und Überraschung ist sehr einfach.
 „Der Unterschied zwischen Suspense und Überraschung ist sehr einfach. Dennoch werden diese Begriffe oft verwechselt“, erklärt Alfred Hitchcock in einem Interview mit François Truffaut in onkelhaftem Five–o’Clock–Tea–Tonfall. Für den Großmeister des Suspense und Magier der Zuschauermanipulation gehörte die Überraschung als filmische Strategie eher zu den langweiligeren Verfahren, wie er Truffaut gegenüber doziert: „Wir reden miteinander, vielleicht ist eine Bombe unterm Tisch, und wir haben eine ganz gewöhnliche Unterhaltung, nichts Besonderes passiert, und plötzlich, bumm, eine Explosion. Das Publikum ist überrascht. Schauen wir uns jetzt den Suspense an. Die Bombe ist unterm Tisch, und das Publikum weiß es. Nehmen wir an, weil es gesehen hat, wie der Anarchist sie da hingelegt hat. Das Publikum weiß, daß die Bombe um 1 Uhr explodieren wird, und jetzt ist es 12 Uhr 55. Dieselbe unverfängliche Unterhaltung wird plötzlich interessant, weil das Publikum an der Szene teilnimmt. Es möchte den Leuten auf der Leinwand zurufen: Reden Sie nicht über so banale Dinge, unter Ihrem Tisch ist eine Bombe, und gleich wird sie explodieren! Im ersten Fall hat das Publikum 15 Sekunden Überraschung beim Explodieren der Bombe. Im zweiten Fall bieten wir ihm 5 Minuten Suspense.“
„Der Unterschied zwischen Suspense und Überraschung ist sehr einfach. Dennoch werden diese Begriffe oft verwechselt“, erklärt Alfred Hitchcock in einem Interview mit François Truffaut in onkelhaftem Five–o’Clock–Tea–Tonfall. Für den Großmeister des Suspense und Magier der Zuschauermanipulation gehörte die Überraschung als filmische Strategie eher zu den langweiligeren Verfahren, wie er Truffaut gegenüber doziert: „Wir reden miteinander, vielleicht ist eine Bombe unterm Tisch, und wir haben eine ganz gewöhnliche Unterhaltung, nichts Besonderes passiert, und plötzlich, bumm, eine Explosion. Das Publikum ist überrascht. Schauen wir uns jetzt den Suspense an. Die Bombe ist unterm Tisch, und das Publikum weiß es. Nehmen wir an, weil es gesehen hat, wie der Anarchist sie da hingelegt hat. Das Publikum weiß, daß die Bombe um 1 Uhr explodieren wird, und jetzt ist es 12 Uhr 55. Dieselbe unverfängliche Unterhaltung wird plötzlich interessant, weil das Publikum an der Szene teilnimmt. Es möchte den Leuten auf der Leinwand zurufen: Reden Sie nicht über so banale Dinge, unter Ihrem Tisch ist eine Bombe, und gleich wird sie explodieren! Im ersten Fall hat das Publikum 15 Sekunden Überraschung beim Explodieren der Bombe. Im zweiten Fall bieten wir ihm 5 Minuten Suspense.“
Es ist ein fast schon sadistisches Konzept von Thrill, das Hitchcock da in seiner kurzen Ausführung vor uns entfaltet, ein hämisches, elegisch– langsames Zerquälen der Zuschauerseele, dessen Effekt in einer spezifischen Art von Gefühlskontrolle liegt: Durch das Moment der Mehrinformation des Kinogängers gegenüber den Figuren auf der Leinwand nämlich, auf dem der von Hitchcock bis zum Exzeß verwendete Effekt der tragischen Ironie basiert, wird der Zuschauer dazu gebracht, angesichts einer prekären Situation seinen spontanen Handlungsimpuls durch Eingreifen der Vernunft zu unterdrücken, seine Emotionen zu korsettieren und die Ambivalenz zwischen Wollen und Nichtkönnen während zäh zerfließender Minuten auszuhalten. Hitchcocks Idee des Suspense scheint dadurch zunächst weniger mit antik–dramentheoretischer Affektlehre und der kathartischen Reinigung durch Gefühle zu tun zu haben als im Gegenteil gerade mit einer vom Regisseur genüßlich dirigierten Zwanghaftigkeit: einer kalkulierten Anspannung, die keine Entladung und keine Erlösung, nur ein nebensächliches Abklingen findet.
Geschichten von lebendigen Menschen
Was mich zum Film geführt hat, ist vor allem das Bedürfnis, Geschichten von lebendigen Menschen zu erfahren, von Menschen, die inmitten der Dinge leben, und nicht von den Dingen selbst. Hier findet man nirgends die endgültige Wahrheit, aber die Wahrhaftigkeit und die Menschlichkeit, die einen tieferen Ursprung hat als die gebildete Humanität. Mir geht es um eine historische Poetik des Kinos, um das Verstehen der verschiedenen narrativen und visuellen Verfahren, die das Medium in seiner hervorgebracht hat. Was ich an meinem Lieblingsfilmen schätze, ist der Reichtum an wunderbaren Zeichen, die sich im Licht ihrer fehlenden Erklärung offenbarten. Seine Besonderheit bezieht das Kino nicht aus der Narration oder der Dramaturgie, sondern aus den Formen und Schattierungen, die sich im Lauf seiner Projektion zu einer imaginären Welt verdichten. Das Kino, das mich interessiert, ist ein anthropomorphes. Mein Augenmerk liegt stets auf den Menschen. Meine Augen reagieren nachhaltig, sie können sich nicht lösen. Von dieser Trägheit lebt die Projektion. Kino ist ein Ganzes nennen wir es: „die Wirklichkeit“, diese wird geteilt und wieder zusammengesetzt zu etwas Neuem, nennen wir es: „den Film“: Wobei nicht nur verschiedene Menschen, sondern auch verschiedene Maschinen zum Einsatz kommen. Die wichtigsten sind die Kamera, der Montagetisch und der Projektor. Kino entsteht erst im Prozeß der Wahrnehmung. Genau das macht die Magie aus – wenn die Bilder sich im Innern neu zusammensetzen.
Die zitternde Welt im Spiegel einer Pfütze
Tief Luft holen, ab in die Fluten. Tauchen, tauchen, so schnell es die Muskeln gestatten, tiefer und tiefer, bis die Lungenflügel tanzen, bis die Nerven zittern, bis die Haut sich nach Kiemen sehnt. Dann gibt es nur noch Blau, Blau, so weit das Auge reicht. „Die zitternde Welt im Spiegel einer Pfütze“ – es war die Ruinenlandschaft der Moderne, die Siegfried Kracauer in dieses Bild faßte. Er hat sich in der Ruinenlandschaft mit einer solchen aggressiven Expressivität bewegt, daß seine – als Redakteur der Frankfurter Zeitung für das Feuilleton geschriebenen – Texte in den 20er und beginnenden 30er Jahren großes Aufsehen erregten. Die Fremdheit des Blicks und das kalte Wehen in seinen Sätzen haben die Leser überrascht, als werde einem die bekannte Welt wie ein wildfremder Ort gespiegelt, an dem alle bekannten Dinge nur als chaotische Wucherungen der Sinnlosigkeit erscheinen.
Dem Tod bei der Arbeit zuschauen
Das Kino, dessen Stärke ja nach Cocteau darin besteht, dem Tod bei der Arbeit zuzuschauen, hält sich auch einiges auf seine Fähigkeit zu Gute, Wunden zu heilen. Im Kino, sagt man, überleben die Mythen. Tatsächlich aber verblassen die eigentlichen Kinomythen oft überraschend schnell. Das kollektive Gedächtnis ist eine Schultafel, die sich von selbst auswischt. Nur noch winzige Spuren bleiben zurück. Das hat durchaus sein Gutes: So staunt man umso unbefangener über das, was einmal selbstverständlich war – die Wirkung imposanter Landschaftsphotografie auf ein existentielles Drama in einem Piratenfilm oder den Zauber eines realistischen Schiffsmodells in einer Waschschüssel.
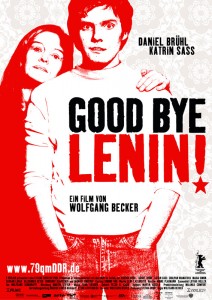 Seit dreißig Jahren befasse ich mich zunehmend mit Bildern und versuche, diese nicht mehr nur als bloße Illustration der aus Texten gewonnenen Erkenntnisse zu benutzen, sondern als eigenständigen Zugang zur Geschichte ernst zu nehmen. Damals hatte man ein „Feindbild“. Zum Lamento einer vorwiegend konservativen Kulturkritik gehört der Tadel für eine geschichtsblinde, unwissende junge Generation. Dabei findet Geschichte unentwegt statt. Medial vermittelte, bebilderte Geschichte erlebt eine nie gekannte Konjunktur. Der moderne nationale Geschichts–Unterricht spielt sich vorzugsweise im Fernsehen ab, das auch in diesem Genre einst klassisches Kino–Terrain erobert hat. Dem chronisch pubertären, Komödien orientierten deutschen Film ist nach dem kritischen Gesellschaftsfilm und dem Krimi nun auch der Historienfilm abhanden gekommen. Eichingers »Untergang« und Wolfgang Beckers »Good Bye Lenin« zum Trotz: Die Verfügungsgewalt und die Deutungsmacht über deutsche Zeitgeschichte hat das Fernsehen, gleich ob öffentlich–rechtlich oder kommerziell, spätestens mit millionenteuren und millionenfach gesehenen Filmen wie Dresden, der Berliner Luftbrücke und der Hamburger Sturmflut an sich gerissen. Die Methodendiskussion, spricht zu Beginn des 21. Jahrhunderts lieber von „Identität“ und „Alterität“, um das Aufeinander–bezogen–Sein von Fremd– und Selbstbildern differenziert zu erfassen. Besonders Widerwärtig ist die Geschichtspornographie des Chefhistorikers Guido Knopp. Die auf billige Dramatisierung, seichte Emotionalisierung und inhaltsleere Pseudoauthentizität setzenden Produktionen Knopps werden nicht etwa von einem „privaten Sender“ produziert, sondern von einer öffentlich rechtlichen Anstalt. Die Filmchen huldigen dem Prinzip der unbedingten Authentizität. Dieses Prinzip eines naturalistischen, detailverliebten Erzählens teilen sie mit einer anderen Gruppe von Geschichtsfilmen, jenen, die die katastrophalen Entgleisungen der Historie selbst, die Barbarei des Dritten Reichs, zum Gegenstand haben. Letzten hörte ich einer Podiums-Diskussion zu, in der es darum ging, ob man als deutscher Schauspieler einen Nazi spielen darf, ob das legitim ist, daß man damit Geld verdient. Ich habe mir gedacht: „Natürlich darf man das. Wieso soll man es nicht dürfen. Die Frage ist, in welchem Zusammenhang macht man es.“ Wenn man es so macht bei diesem Untergangsfilm von Eichinger macht, habe ich den Verdacht, die Beteiligten hätten auch bei den Ufa mitgemacht. Mit Verlaub, aber „Der Untergang“ ist absoluter Dreck. Der Versuch, diese ‚Herrenmenschen’ eins zu eins wiederzugeben, realistisch, ist völlig peinlich. Ich saß im Kino und habe eine Dreiviertelstunde lang gedacht, der Bruno Ganz habe hinter dem Rücken von Fest und Eichinger eine richtig gute Parodie auf Hitler gemacht. Dann habe ich gemerkt: Der meint das total ernst! So total, daß ich ihn nicht mehr glaubwürdig als Interpret von Eichendorf-Gedichten hören kann, ohne an dies Schmiere zu denken. Bekanntlich haben Filmprojekte, die sich irgendwie vergangenheitsbewältigend mit der Nazizeit befassen, bei deutschen Fördergremien einen politisch-moralischen Bonus. Was zu einem Überangebot von Hakenkreuzfahnen, sadistischen SS-Schergen und KZ-Horror auf der Leinwand – und bei mir zu Abwehrreaktionen – führt. Fiktive Authenzität und fanatische Wirklichkeitstreue sind als historical correctness unangreifbar geworden. So mag in Eichingers Kostümfilm jeder Uniformknopf der richtige sein, über Wesen und Unwesen der Naziherrschaft erfährt man nichts. Das Schlimme an dieser Art von Biopics ist, daß sie ständig vorgeben, Antworten zu liefern, während sie doch nur alte Gewißheiten perpetuieren. Biographien werden runtergebrochen auf eine Abfolge von Schlaglichtern und Schlüsselmomenten. Im Biopic kommen alle schlechten Eigenarten des Kinos zusammen, die es letztlich wieder nur auf traditionelle Kunstformen zurückwerfen. Starre Begriffe wie Werktreue, Subjektbildung und Figurenpsychologie degradieren das Kino zu einer Bildermaschine zweiter Ordnung, bis die Kinobilder nichts mehr darstellen als sich selbst. Die Frakturlinien einer Biographie werden überblendet, ihre Widersprüche notdürftig psychologisiert, mehrere Jahrzehnte auf zwei Stunden zusammengeschoben – das Resultat erinnert in den meisten Fällen an lieblos zusammengestellte Best–Of–CDs. Ein Vierteljahrhundert nach der bahnbrechenden Ausstrahlung der US–Serie »Holocaust« ist auf dem Niveau der Knopp–Schnipsel von Tabubruch und Affekt–Erschütterung nicht mehr viel übrig geblieben. Diese Form der Erotisierung von Geschichte kann sich auf Kino–Vorbilder wie Casablanca berufen, auf den Spuren von Spielbergs Schindlers Liste erfüllen diese Filme die tiefe deutsche Sehnsucht nach Retter–Geschichten und den Wunsch, daß es inmitten all des Schrecklichen Inseln der Positivität geben möge, Helden. Geschichtsbilder beruhen auf Bildern. Wie, so könnte man auch fragen, entstehen „Bilder in den Köpfen“, wie werden sie geschichtsmächtig, wenn sie für größere Kollektive und soziale Gruppen Plausibilität und handlungsleitende Wirkung entfalten?
Seit dreißig Jahren befasse ich mich zunehmend mit Bildern und versuche, diese nicht mehr nur als bloße Illustration der aus Texten gewonnenen Erkenntnisse zu benutzen, sondern als eigenständigen Zugang zur Geschichte ernst zu nehmen. Damals hatte man ein „Feindbild“. Zum Lamento einer vorwiegend konservativen Kulturkritik gehört der Tadel für eine geschichtsblinde, unwissende junge Generation. Dabei findet Geschichte unentwegt statt. Medial vermittelte, bebilderte Geschichte erlebt eine nie gekannte Konjunktur. Der moderne nationale Geschichts–Unterricht spielt sich vorzugsweise im Fernsehen ab, das auch in diesem Genre einst klassisches Kino–Terrain erobert hat. Dem chronisch pubertären, Komödien orientierten deutschen Film ist nach dem kritischen Gesellschaftsfilm und dem Krimi nun auch der Historienfilm abhanden gekommen. Eichingers »Untergang« und Wolfgang Beckers »Good Bye Lenin« zum Trotz: Die Verfügungsgewalt und die Deutungsmacht über deutsche Zeitgeschichte hat das Fernsehen, gleich ob öffentlich–rechtlich oder kommerziell, spätestens mit millionenteuren und millionenfach gesehenen Filmen wie Dresden, der Berliner Luftbrücke und der Hamburger Sturmflut an sich gerissen. Die Methodendiskussion, spricht zu Beginn des 21. Jahrhunderts lieber von „Identität“ und „Alterität“, um das Aufeinander–bezogen–Sein von Fremd– und Selbstbildern differenziert zu erfassen. Besonders Widerwärtig ist die Geschichtspornographie des Chefhistorikers Guido Knopp. Die auf billige Dramatisierung, seichte Emotionalisierung und inhaltsleere Pseudoauthentizität setzenden Produktionen Knopps werden nicht etwa von einem „privaten Sender“ produziert, sondern von einer öffentlich rechtlichen Anstalt. Die Filmchen huldigen dem Prinzip der unbedingten Authentizität. Dieses Prinzip eines naturalistischen, detailverliebten Erzählens teilen sie mit einer anderen Gruppe von Geschichtsfilmen, jenen, die die katastrophalen Entgleisungen der Historie selbst, die Barbarei des Dritten Reichs, zum Gegenstand haben. Letzten hörte ich einer Podiums-Diskussion zu, in der es darum ging, ob man als deutscher Schauspieler einen Nazi spielen darf, ob das legitim ist, daß man damit Geld verdient. Ich habe mir gedacht: „Natürlich darf man das. Wieso soll man es nicht dürfen. Die Frage ist, in welchem Zusammenhang macht man es.“ Wenn man es so macht bei diesem Untergangsfilm von Eichinger macht, habe ich den Verdacht, die Beteiligten hätten auch bei den Ufa mitgemacht. Mit Verlaub, aber „Der Untergang“ ist absoluter Dreck. Der Versuch, diese ‚Herrenmenschen’ eins zu eins wiederzugeben, realistisch, ist völlig peinlich. Ich saß im Kino und habe eine Dreiviertelstunde lang gedacht, der Bruno Ganz habe hinter dem Rücken von Fest und Eichinger eine richtig gute Parodie auf Hitler gemacht. Dann habe ich gemerkt: Der meint das total ernst! So total, daß ich ihn nicht mehr glaubwürdig als Interpret von Eichendorf-Gedichten hören kann, ohne an dies Schmiere zu denken. Bekanntlich haben Filmprojekte, die sich irgendwie vergangenheitsbewältigend mit der Nazizeit befassen, bei deutschen Fördergremien einen politisch-moralischen Bonus. Was zu einem Überangebot von Hakenkreuzfahnen, sadistischen SS-Schergen und KZ-Horror auf der Leinwand – und bei mir zu Abwehrreaktionen – führt. Fiktive Authenzität und fanatische Wirklichkeitstreue sind als historical correctness unangreifbar geworden. So mag in Eichingers Kostümfilm jeder Uniformknopf der richtige sein, über Wesen und Unwesen der Naziherrschaft erfährt man nichts. Das Schlimme an dieser Art von Biopics ist, daß sie ständig vorgeben, Antworten zu liefern, während sie doch nur alte Gewißheiten perpetuieren. Biographien werden runtergebrochen auf eine Abfolge von Schlaglichtern und Schlüsselmomenten. Im Biopic kommen alle schlechten Eigenarten des Kinos zusammen, die es letztlich wieder nur auf traditionelle Kunstformen zurückwerfen. Starre Begriffe wie Werktreue, Subjektbildung und Figurenpsychologie degradieren das Kino zu einer Bildermaschine zweiter Ordnung, bis die Kinobilder nichts mehr darstellen als sich selbst. Die Frakturlinien einer Biographie werden überblendet, ihre Widersprüche notdürftig psychologisiert, mehrere Jahrzehnte auf zwei Stunden zusammengeschoben – das Resultat erinnert in den meisten Fällen an lieblos zusammengestellte Best–Of–CDs. Ein Vierteljahrhundert nach der bahnbrechenden Ausstrahlung der US–Serie »Holocaust« ist auf dem Niveau der Knopp–Schnipsel von Tabubruch und Affekt–Erschütterung nicht mehr viel übrig geblieben. Diese Form der Erotisierung von Geschichte kann sich auf Kino–Vorbilder wie Casablanca berufen, auf den Spuren von Spielbergs Schindlers Liste erfüllen diese Filme die tiefe deutsche Sehnsucht nach Retter–Geschichten und den Wunsch, daß es inmitten all des Schrecklichen Inseln der Positivität geben möge, Helden. Geschichtsbilder beruhen auf Bildern. Wie, so könnte man auch fragen, entstehen „Bilder in den Köpfen“, wie werden sie geschichtsmächtig, wenn sie für größere Kollektive und soziale Gruppen Plausibilität und handlungsleitende Wirkung entfalten?
Was ist ein guter Film?
Es gibt leise Filme, die ihren Weg durch die kleinen Kinos machen; es gibt ehrgeizige, bescheidene und belanglose Filme, deren einziger Anspruch darin besteht, uns zwei Stunden unserer sorgsam gehüteten quality time zu stehlen. Und es gibt brachiale Monster–Projekte, die nicht nur die Maschinerien der Kulturindustrie fratzenhaft offenbaren, sondern zugleich auch das älteste Dilemma der Filmkritik überhaupt: Was ist ein guter Film? – Wie schafft man eine es, einen erfolgreichen Film zu drehen? – Der nicht nur mit Preisen auf Festivals überhäuft wird, sondern sogar bei den Oscar–Nominierungen auftaucht? – Einen Film, der obendrein beim Publikum beliebt ist, will sagen, sich an der Kinokasse bezahlt macht?
Die meisten Produzenten, die einen Oscar bekommen, benutzen die Kamera nur, um selbst zu existieren. Sie benutzen sie nicht, um etwas zu sehen, was man ohne Kamera nicht sieht. So wie ein Wissenschaftler manche Dinge nicht ohne Mikroskop erkennen kann. Oder der Astronom manche Sterne nicht ohne Teleskop. Es ist nicht mehr so leicht, die Kamera zu benutzen, um etwas zu sehen, was man sonst nicht sieht. Entweder die Regisseure bestätigen, was sie schon wissen. Oder sie bestätigen sich selbst mit der Kamera. So wie sich früher ein Ritter mit der Lanze bestätigt hat. Man rettet sich nicht selbst, indem man die Welt rettet. Das Schöne am Kino ist, dass es uns immer noch erlaubt, uns zu streiten. Und zwar grundsätzlich. Man ärgert sich über die andere Meinung zu einem Film viel mehr, als wenn es um ein Gemälde oder um ein Musikstück geht. Es geht immer um die Beziehung zum Bild. Ich meine zum wirklichen Bild, nicht zum fotografierten Text.
Hat nicht die große Menge zahlender Zuschauer letztlich immer Recht?
„Von einer Brücke herunter ins Wasser spucken“ – so hat der französische Filmhistoriker André Bazin einmal die Filmkritik definiert. Auf den Kassenerfolg hat Kritik keinen Einfluß. Doch kleinen, höchst geschätzten Filmen kann die Filmkritik eine Aufmerksamkeit verschaffen, die diesen sonst nie zuteil würde. Dieses Engagement führt meist nicht zu einem besonderen Kassenerfolg. Wer sich allerdings in der Filmgeschichte umsieht, wird schnell festzustellen, daß die meisten stilbildenden Klassiker auch nicht besonders erfolgreich waren. Zeichnet sich ein sehenswerter Film durch eine konzise Produktion aus, also durch die sorgfältige, vielleicht sogar intelligente Umsetzung eines Stoffs – die im Betrachter idealerweise einen metaphysischen oder emotionalen Mehrwert, einen kleinen Sinn–Funken zu entzünden vermag? Oder stellt sich Qualität erst nachträglich in Form eines kommerziellen Erfolgs an der Kinokasse her? Hat nicht die große Menge zahlender Zuschauer letztlich immer Recht?
Längst ist es schon in der Zeitung Routine, das so genannte Rezensionsfeuilleton als langweilig und überholt zu schmähen. Denn anders als die Debatte, das Porträt und das Interview mit ihrem Reigen prominenter Beiträger, ihren attraktiven Gesichtern und starken Meinungen, wartet die Besprechung lediglich mit Beschreibung und Erklärung auf. Das scheint zunächst nur die schon Interessierten zu interessieren – was die Sache gleich weitestgehend delegitimiert. Wertschätzung gibt es dort, wo ein allgemeines Interesse vermutet wird. Daher ist die Filmkritik unangefochtene Königsdisziplin – kein Interesse an Kino? Undenkbar. Kino geht alle an.
Kanon oder Kultfilm?
Es gibt ihn zwar noch, den individualistischen Kinogänger, der sich für diese Zahlenspiele überhaupt nicht interessiert und der sich seine Filme nach Inhalt und Kritikerbewertungen aussucht. Die Mehrheit jedoch, und durch sie bekommt der Spruch vom erfolgreichen Erfolg seine Wirkungsmacht, begreift diese Rekorde als Motivation: Den erfolgreichsten Film des Jahres, des Jahrzehnts, aller Zeiten muß man doch einfach gesehen haben! So wird „Erfolg“ zu einem Ereignis, an dem möglichst viele teilhaben wollen.
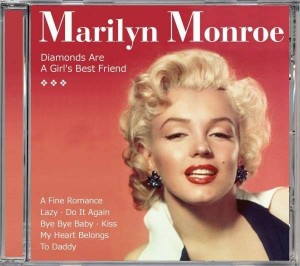 „Diamonds are a girl’s best friend“, hauchte Marilyn Monroe alias Lorelei Lee 1953 in Howard Hawks »Gentlemen prefer Blondes«. Das Showgirl Lee trug ein schulterfreies, rosafarbenes Seidenkleid und ließ sich von einem halben Dutzend Kerlen in Smokings anhimmeln. Nicht Jane Russell, die den Song später in dem Film in einer Gerichtsszene noch einmal singt, die Monroe hat die Hymne aller lebensklugen, berechnenden, von den Männern enttäuschten Frauen geschaffen. Madonna hat den Song adaptiert, Nicole Kidman 2001 in „Mulin Rouge“. Nur der ewigen Treue von Diamanten ist zu trauen. Das sehen in den USA längst nicht mehr nur Frauen so.
„Diamonds are a girl’s best friend“, hauchte Marilyn Monroe alias Lorelei Lee 1953 in Howard Hawks »Gentlemen prefer Blondes«. Das Showgirl Lee trug ein schulterfreies, rosafarbenes Seidenkleid und ließ sich von einem halben Dutzend Kerlen in Smokings anhimmeln. Nicht Jane Russell, die den Song später in dem Film in einer Gerichtsszene noch einmal singt, die Monroe hat die Hymne aller lebensklugen, berechnenden, von den Männern enttäuschten Frauen geschaffen. Madonna hat den Song adaptiert, Nicole Kidman 2001 in „Mulin Rouge“. Nur der ewigen Treue von Diamanten ist zu trauen. Das sehen in den USA längst nicht mehr nur Frauen so.
Zähne zeigen, Schultern straffen – ein wenig erinnert das Casting, das Hollywood–Schauspielerinnen durchlaufen müssen, an einen modernen Sklavenmarkt. Die Kamera tastet ihr Profil ab, ihre Haut, ihre Haare, als wolle sie eine Genprobe nehmen. Verbirgt sich unter ihrer ebenmäßigen Stirn der Stoff, aus dem die Filmträume sind?
Nachdem Lars von Trier den Dogma–Fluch in die Welt geschickt hat, haben wir uns daran gewöhnt, daß die visuelle Nachlässigkeit manch junger Film– bzw. Videomacher als ästhetisches Konzept durchgeht. Seit der Einfluß des US–Fernsehens durch innovative Serien an Bedeutung gewinnt, gleicht die Dramaturgie von Filmen wie Syriana und L.A. Crash in ihrem Drei–Minuten–Takt eher dem Schema einer Fernsehserie als dem eines „klassischen“ Kinofilms (und nein: mit dem Altman–Meisterwerk Nashville läßt sich das überhaupt nicht vergleichen!).
Errettung der äußeren Wirklichkeit
Die von Siegfried Kracauer beschworene „Errettung der äußeren Wirklichkeit“ hat in Zeiten der Digitalisierung wieder Konjunktur. Das Kino abseits des Mainstreams sucht das Gegengewicht zur totalen Verfügbarkeit der Bilder und hat ihre Antwort in der schweren Kunst gefunden, scheinbar kunstlos zu erzählen. Natürlich zeigen diese Filme so wenig das Leben selbst wie Kracauers „leicht angedeutete Erzählung“, doch haben sie kein alles bestimmendes Dogma im Gepäck. Die Digitalisierung gleich einer Operationen am offenen Herzen des Kinos. Der Film läßt sich nicht in technologischen Begriffen definieren. Dies belegt auch der Umbruch, in dem sich heute sein Aufnahmeverfahren befindet: Erstmals ist im Lauf der letzten Jahre eine signifikante Anzahl der hergestellten Produktionen mit einer digitalen Kamera aufgenommen worden. Diese Filme, darunter «Die Sonne» von Alexander Sokurow, «Iklimler – Die Klimas» des Türken Nuri Bilge Ceylan, «Un couple parfait» von Nobuhiro Suwa, «Miami Vice» von Michael Mann, unterscheiden sich sowohl in ihrem künstlerischen Gestus als auch hinsichtlich ihrer Herkunft. Sie resultieren jedoch alle aus einem Produktionsprozess, der nicht nur auf der bereits üblichen Informatisierung von Schnitt und Ton, sondern auch auf einer nicht analogen Bildaufnahme beruht.
Unterdessen arbeitet die Mythenmaschine Hollywood arbeitet am digitalen Schauspieler. Mit Hilfe eines hochleistungsfähigen Rechners läßt sich im Film inzwischen so ziemlich alles simulieren, vom Schiffsuntergang bis zum Riesengorilla. Digitale Schauspieler haben weder Starallüren noch Gagenforderungen. Eine theoretische Herausforderung stellt die Revolution in der Bildakquisition zudem aufgrund ihres spezifischen Verhältnisses zur mimetischen Darstellung dar. Denn der Bruch mit dem traditionellen Produktionsmodus liegt zweifellos hier: Die digitalen Filme gründen auf einem Verfahren, das im Gegensatz zur analogen Wiedergabe in der mathematischen Verarbeitung der von der Linse aufgenommenen Lichtenergie besteht. Die Konsequenz dieser Entwicklung – daß, verkürzt ausgedrückt, die filmische Materie nicht mehr aus der äusseren Wirklichkeit besteht, sondern aus ihrem auf dem Kontrollbildschirm erscheinenden, modifizierbaren Abbild – ist insofern von Interesse, als sie das „absolut Besondere“, das Roland Barthes der Fotografie einst als Garant der direkten Beziehung zwischen dem Objektiv und dem dargestellten Objekt zuschrieb, in Frage stellt. Wenn die Gefährten im ersten Teil von Peter Jacksons Herr der Ringe–Trilogie über eine zusammenstürzende Treppe der Freiheit entgegeneilen oder Spider–Man einen halsbrecherischen Kampf in den Straßenschluchten von New York austrägt, sind es also nicht Schauspieler, sondern ihre digitalen Doppelgänger. Die mit Hilfe der ebenfalls für die Herr der Ringe–Filme entwickelten Software „Massive“ erschaffenen Soldaten sind sogar mit einem gewissen Maß an künstlicher Intelligenz ausgestattet, das es ihnen erlaubt, adäquat auf die Kampfhandlungen ihres jeweiligen Gegners zu reagieren. Was bleibt, ist ihr Substrat: Es ist das der digitalen Aufnahme innewohnende Simulationspotenzial, das der zeitgenössischen Wahrnehmung zu einem neuen visuellen Ausdruck verhilft. Hollywood ist, es tut, aber es bedeutet nicht.
Nachmodellieren menschlicher Formen
Jeder von uns trägt ein Bild unentwegt mit sich, sein ganzes Leben lang, diesem Bild gerecht zu werden, ist für einen Schauspieler eine vertrackte, wenn nicht unmögliche Aufgabe. Stimmt Walter Benjamins Satz, gemäß dem sich mit den «geschichtlichen Zeiträumen auch die Sinneswahrnehmung der menschlichen Kollektiva verändert», ließe sich in der digitalen Technologie vielleicht selbst die Signatur der Epoche sehen. Neben dem digitalen Nachmodellieren menschlicher Formen im Computer ist es vor allem die Idee, Tote durch Manipulation vorhandenen Filmmaterials „wiederzuerwecken“, die es den Filmemachern angetan hat. Bereits 1994 gelang es dem Team von Forrest Gump, Tom Hanks eine Audienz bei John F. Kennedy und Richard Nixon zu verschaffen. Dafür wurden Nachrichtenaufnahmen, die Kennedy und Nixon zeigten, Pixel für Pixel im Computer so umgestaltet, daß die US–Präsidenten glaubwürdig mit dem neben ihnen in die Aufnahmen kopierten Hanks interagieren konnten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
„Es gibt nur eine Möglichkeit, sich vor der Maschine zu retten. Das ist, sie zu benützen“, schrieb Karl Kraus. Je länger wir mit der Technologie umgehen, desto mehr entdecken wir, was sie nicht kann. Und aus der Fehlerhaftigkeit und den Schwächen der Computerwelt vermittelt das Denken der Nichtmaschine Mensch ein lebendiges Gefühl von Souveränität. Jenseits zwischen Kino–Transzendenz und Kino–Unbewußtem schickt David Lynchs in »Inland Empire« eine digital gedrehte Traumreise durch den Kopf einer Schauspielerin. Laura Dern durchwandelt die verschiedenen Paranoiastadien dieser Frau, während sich auf ihrem Gesicht Verwunderung und Hysterie, Angst und Panik spiegeln. Gleich zu Beginn erfährt die Heldin auf einem Filmset, daß im Drehbuch noch eine weitere Geheimgeschichte verborgen ist, in deren Verlauf die Hauptdarsteller ermordet werden. Immer tiefer dringen wir mit ihr in bedrohliche Traum– und Parallelwelten ein. Irgendwann, wenn Raum– und Zeitgefühl längst aufgehoben sind, rammt jemand der Schauspielerin einen Schraubenzieher in den Bauch. In einem ergreifenden Todeskampf kotzt Laura Dern ihr Blut auf Hollywoods Walk of Fame. Ihr langsames Sterben, das Verlöschen ihres Blickes, ist der ergreifendste und wahrhaftigste Moment dieses Mediums.
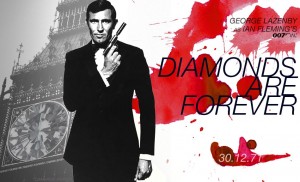 Mut kommt im Kino häufig vor. Denn Mut ist ein Charakterzug, der ins Zeitalter der Spezialeffekte besser paßt als Bescheidenheit, Verläßlichkeit, Güte, weil man ihn so gut bebildern kann. Er ist die Utopie, die übrig bleibt, wenn der Hollywoodorkan losbricht, die Motorboote explodieren, die Hochhäuser schwanken, die Raumschiffe kollidieren und nur noch Helden wie Arnold Schwarzenegger eine oder der Agent mit der Doppelnull eine Chance haben. Gewalt und Grausamkeit sind nicht das Problem. Sie sind legitime filmische Gegenstände. Der Film »erlöst das Grauenhafte aus seiner Unsichtbarkeit hinter den Schleiern von Panik und Fantasie«, hat Siegfried Krakauer in seiner Filmtheorie geschrieben. Eigentlich sind Bondfilme ultrapeinlich. Allein die Plakate: ein Mann im Smoking, die Pistole neben der Nase. Auf geradezu rührende Weise erfüllte sich mit der Doppel-Null die Männerfantasie einer ewigen Gegenwart williger Mädchen, dienstfertiger Barmänner und lustiger Spielzeuge. Natürlich ist das Peinliche auch das Attraktive: Die geistreiche Konversation mit Manieren und Martinis verkleidet nur notdürftig die kindische Größenfantasie eines Scherzartikel–Spions. Bond schaffte den Wechsel von Sean Connerys domestiziertem Barbarentum zu Roger Moores gelassener sophistication. Selbst ein Buchhalter–Typus wie George Lazenby konnte 007 nichts anhaben, und besonders Pierce Brosnan ging virtuos damit um, feuchte Träume zu verkörpern. Darüber hinaus öffnete er das Genre für die weibliche Machtfantasie und machte es so auch für Frauen attraktiv. Die Zeit der selbstironischen Playboys ist vorüber. Das Miss Moneypenny pensioniert wurde, ist kein großer Verlust, aber das der Schuss Monty–Python durch den Waffen– und Technikbastler Q fehlt, ist ein tragischer Verlust. Auch Judi Denchs „M“ kann das nicht kompensieren. Gut, wir wissen nun, daß dieser Blond seien 00 im wahrsten Sinne des Ortes auf der Toilette erwarben hat. Genauso flach, wie dieser Witz ist die Handlung von 21. Mit der Blondine ist 007 wieder etwas für Jungs, die auf der Straße stehen bleiben, wenn irgendwo ein roter Sportwagen parkt, und anfangen, mit Wildfremden über Hubraum zu fachsimpeln. Für Jungs, die den Playboy nicht nur unter der Bettdecke lesen, sondern auch später noch daraus ihre Anregungen beziehen. Um es kurz zu machen: Dieser Blondfilm ist etwas für Leute, die sonst mit dem Kino nichts am Hut haben. Viele Romanautoren, Drehbuchschreiber, Filmproduzenten versuchen ihr Glück mit einer Nacherzählung der Adoleszenz bewährter Figuren. »Batman Begins« erzählt, wie die Eltern von Bruce Wayne getötet werden, wie der Junge Rache schwört, wie er sich in Asien zur Kampfmaschine ausbilden läßt. Unter Entbehrungen, unter Schmerzen. Im reanimierten Bond erfährt der Zuschauer durch die scharfsinnige Vesper Lynd, daß er im Waisenhaus aufwuchs. Ein Superheld kann offenbar nur werden, wer Gewalt erfahren und Gewalt ausgeübt, wer außerdem eine mindestens in Ansätzen tragische Vergangenheit hat. Die Szene, in der man Blond erstmals „oben ohne“ sieht, ist ebenso anspielungsreich wie aussagekräftig: Wie einst Ursula Andress in „Dr. No“ entsteigt er lasziv dem Meer, während die Kamera seine Haut erkundet. Blond ist das Objekt der Begierde in diesem Film, eine Schwulenikone. Es gab schon einmal einen ähnlichen Niedergang: 1969 übernahm George Lazenby die Rolle, auf Technikspielereien wurde weitestgehend verzichtet, und auch damals durfte sich 007 tragisch verlieben. Was für ein Film hätte das werden können, wenn Quentin Tarrantino die Originalstory von Ian Fleming mit Pierce verfilmt hätte… So unterscheidet sich dieser Bond kaum von durchschnittlicher amerikanischer Actionware. Der bessere Bond war bereits in Rob Cohens „xXx“ zu sehen: mit Vin Diesel als Geheimagent. Wo 150 Mio $ investiert wird in ein Produkt, muß schließlich auch genügend wieder rauskommen. Der neue Bond ist, ob es uns paßt oder nicht, nach „unseren“ Wünschen gebaut und konstruiert, oder nach dem, was sich die Produzenten darunter vorstellen. Er bildet den Spiegel aktueller gesellschaftlicher Bedürfnisse, kollektiver Träume. Manchmal ist das erstaunlich; oft ziemlich beschämend. Jede Zeit bekommt den Bond, den sie verdient. Das bedeutet jedoch nichts Gutes für unsere Zeit. Ich will den Bond zurück, den wir nicht verdienen.
Mut kommt im Kino häufig vor. Denn Mut ist ein Charakterzug, der ins Zeitalter der Spezialeffekte besser paßt als Bescheidenheit, Verläßlichkeit, Güte, weil man ihn so gut bebildern kann. Er ist die Utopie, die übrig bleibt, wenn der Hollywoodorkan losbricht, die Motorboote explodieren, die Hochhäuser schwanken, die Raumschiffe kollidieren und nur noch Helden wie Arnold Schwarzenegger eine oder der Agent mit der Doppelnull eine Chance haben. Gewalt und Grausamkeit sind nicht das Problem. Sie sind legitime filmische Gegenstände. Der Film »erlöst das Grauenhafte aus seiner Unsichtbarkeit hinter den Schleiern von Panik und Fantasie«, hat Siegfried Krakauer in seiner Filmtheorie geschrieben. Eigentlich sind Bondfilme ultrapeinlich. Allein die Plakate: ein Mann im Smoking, die Pistole neben der Nase. Auf geradezu rührende Weise erfüllte sich mit der Doppel-Null die Männerfantasie einer ewigen Gegenwart williger Mädchen, dienstfertiger Barmänner und lustiger Spielzeuge. Natürlich ist das Peinliche auch das Attraktive: Die geistreiche Konversation mit Manieren und Martinis verkleidet nur notdürftig die kindische Größenfantasie eines Scherzartikel–Spions. Bond schaffte den Wechsel von Sean Connerys domestiziertem Barbarentum zu Roger Moores gelassener sophistication. Selbst ein Buchhalter–Typus wie George Lazenby konnte 007 nichts anhaben, und besonders Pierce Brosnan ging virtuos damit um, feuchte Träume zu verkörpern. Darüber hinaus öffnete er das Genre für die weibliche Machtfantasie und machte es so auch für Frauen attraktiv. Die Zeit der selbstironischen Playboys ist vorüber. Das Miss Moneypenny pensioniert wurde, ist kein großer Verlust, aber das der Schuss Monty–Python durch den Waffen– und Technikbastler Q fehlt, ist ein tragischer Verlust. Auch Judi Denchs „M“ kann das nicht kompensieren. Gut, wir wissen nun, daß dieser Blond seien 00 im wahrsten Sinne des Ortes auf der Toilette erwarben hat. Genauso flach, wie dieser Witz ist die Handlung von 21. Mit der Blondine ist 007 wieder etwas für Jungs, die auf der Straße stehen bleiben, wenn irgendwo ein roter Sportwagen parkt, und anfangen, mit Wildfremden über Hubraum zu fachsimpeln. Für Jungs, die den Playboy nicht nur unter der Bettdecke lesen, sondern auch später noch daraus ihre Anregungen beziehen. Um es kurz zu machen: Dieser Blondfilm ist etwas für Leute, die sonst mit dem Kino nichts am Hut haben. Viele Romanautoren, Drehbuchschreiber, Filmproduzenten versuchen ihr Glück mit einer Nacherzählung der Adoleszenz bewährter Figuren. »Batman Begins« erzählt, wie die Eltern von Bruce Wayne getötet werden, wie der Junge Rache schwört, wie er sich in Asien zur Kampfmaschine ausbilden läßt. Unter Entbehrungen, unter Schmerzen. Im reanimierten Bond erfährt der Zuschauer durch die scharfsinnige Vesper Lynd, daß er im Waisenhaus aufwuchs. Ein Superheld kann offenbar nur werden, wer Gewalt erfahren und Gewalt ausgeübt, wer außerdem eine mindestens in Ansätzen tragische Vergangenheit hat. Die Szene, in der man Blond erstmals „oben ohne“ sieht, ist ebenso anspielungsreich wie aussagekräftig: Wie einst Ursula Andress in „Dr. No“ entsteigt er lasziv dem Meer, während die Kamera seine Haut erkundet. Blond ist das Objekt der Begierde in diesem Film, eine Schwulenikone. Es gab schon einmal einen ähnlichen Niedergang: 1969 übernahm George Lazenby die Rolle, auf Technikspielereien wurde weitestgehend verzichtet, und auch damals durfte sich 007 tragisch verlieben. Was für ein Film hätte das werden können, wenn Quentin Tarrantino die Originalstory von Ian Fleming mit Pierce verfilmt hätte… So unterscheidet sich dieser Bond kaum von durchschnittlicher amerikanischer Actionware. Der bessere Bond war bereits in Rob Cohens „xXx“ zu sehen: mit Vin Diesel als Geheimagent. Wo 150 Mio $ investiert wird in ein Produkt, muß schließlich auch genügend wieder rauskommen. Der neue Bond ist, ob es uns paßt oder nicht, nach „unseren“ Wünschen gebaut und konstruiert, oder nach dem, was sich die Produzenten darunter vorstellen. Er bildet den Spiegel aktueller gesellschaftlicher Bedürfnisse, kollektiver Träume. Manchmal ist das erstaunlich; oft ziemlich beschämend. Jede Zeit bekommt den Bond, den sie verdient. Das bedeutet jedoch nichts Gutes für unsere Zeit. Ich will den Bond zurück, den wir nicht verdienen.
 Mut kann auch unheroisch sein, daran erinnern uns die Filme aus Asien. Die Impulse für ein neues Kino kommen von den Rändern. Der Thailänder Apichatpong Weerasethakul ab konfrontiert das alte und das neue Thailand, indem sich die anfangs natürliche, florale und von menschlichen Kontakten geprägte Umwelt allmählich in eine gespenstische, von der Technik dominierte Szenerie verwandelt. Seine innovative filmische Annäherung an das Phänomen der Erinnerung ist sehr speziell, wie ein Bild aus Gedächtnislücken erschließt, wie sich zugleich fiktive und dokumentarische Filmformen zu einer neuen Form vereinen, das behält seinen Platz auch im Gedächtnis des Kinos. Autonome Bild– und Kameraarbeit hat Priorität vor Plotsklaverei. Metonymisch stehen die so geernteten Bilder für das Seelenleben der Protagonisten und bleiben dabei ambig. Dialoge haben weder mehr Tempo noch eine höhere Frequenz als im naturgemäß kommunikationsbehinderten wirklichen Leben. Das Drama spielt im Kopf der Protagonisten, aus dem nur punktuell kontaktaufnehmende Antennen als Blicke ausgefahren werden und sich einer Welt zuwenden, die die Kamera als eine ebenso schöne wie zwingende Zumutung zu zeigen hat.
Mut kann auch unheroisch sein, daran erinnern uns die Filme aus Asien. Die Impulse für ein neues Kino kommen von den Rändern. Der Thailänder Apichatpong Weerasethakul ab konfrontiert das alte und das neue Thailand, indem sich die anfangs natürliche, florale und von menschlichen Kontakten geprägte Umwelt allmählich in eine gespenstische, von der Technik dominierte Szenerie verwandelt. Seine innovative filmische Annäherung an das Phänomen der Erinnerung ist sehr speziell, wie ein Bild aus Gedächtnislücken erschließt, wie sich zugleich fiktive und dokumentarische Filmformen zu einer neuen Form vereinen, das behält seinen Platz auch im Gedächtnis des Kinos. Autonome Bild– und Kameraarbeit hat Priorität vor Plotsklaverei. Metonymisch stehen die so geernteten Bilder für das Seelenleben der Protagonisten und bleiben dabei ambig. Dialoge haben weder mehr Tempo noch eine höhere Frequenz als im naturgemäß kommunikationsbehinderten wirklichen Leben. Das Drama spielt im Kopf der Protagonisten, aus dem nur punktuell kontaktaufnehmende Antennen als Blicke ausgefahren werden und sich einer Welt zuwenden, die die Kamera als eine ebenso schöne wie zwingende Zumutung zu zeigen hat.
Gangnam style
Namen wie Jun–Min, Jang Jin–Young oder Bae Yong–Joon hat man in Europa noch nie gehört, in Asien sind sie Halbgötter. Von Peking über Vietnam bis Taiwan, Tokyo und Singapur rühren koreanische TV–Love–Storys das Publikum zu Tränen, geben Filmhits und Popstars einen cool–urbanen Korean look vor, während Klienten aus ganz Asien zur boomenden Schönheitschirurgie nach Seoul pilgern, nicht zuletzt um ihren hallyu–Stars ein bißchen ähnlicher zu werden. Neben dem Starrummel bietet das koreanische Kino bietet auch eine extreme Form des Sozialkundeunterrichts. Mit eruptiven Erzählungen und exzessiven Gewaltakten zerschlägt es die hypermodernen Fassaden. Gemeinsam mit der Kamera betritt man die winzigen Hochhauswohnungen und trifft auf Menschen, die noch lange nicht in jener Welt angekommen sind, über deren blinkenden Reklametafeln sie leben. Die zerrissenen Helden dieses Kinos stehen immer kurz vor dem Kontrollverlust. Angesichts ihrer Ohnmacht gegenüber dem Dasein scheint immer alles möglich, ob sie nur auf den Tisch hauen, einen lebendigen Tintenfisch in sich hineinstopfen oder ihrem Gegenüber mit einer Gartenschere die Finger abschneiden. Der ewige Blick nach vorn, auf Erfolg und Anerkennung ist ein Problem der koreanischen Gesellschaft, in der alles schnell vorangehen muß. Daher befaßt man sich auch kaum mit Schuld und Vergangenheit. Aufarbeitung ist nicht Teil des Kulturkonzepts. Gesellschaftlich aufgearbeitet oder gar juristisch verfolgt wurden in Korea weder die Kollaboration während der japanischen Besatzung noch die Massaker und brutalen Unterdrückungen von Opposition und Studentenunruhen während der Militärdiktaturen. Aufarbeitung ist auch nicht das Anliegen des in gesellschaftlichen Angelegenheiten so alerten koreanischen Kinos. Aber das Fehlen der Aufarbeitung ist durchaus ein geheimes Thema. In kaum einer anderen Kinematografie der Welt spielt verzweifelte Rache quer durch die Genres eine so übermächtige Rolle. Auf Koreas Leinwänden rächen Gangster ihre Kameraden, Männer ihre Frauen, Brüder ihre Schwestern. Park Chan–Wook, der wohl international bekannteste koreanische Regisseur, hat eine ganze Trilogie um das Thema Rache gedreht. Ihr dritter Teil, Lady Vengeance, der auch in Deutschland ins Kino kommt, handelt vom grauenvollen Feldzug einer Frau gegen einen Kindermörder. Der Film gipfelt in einer quälend langen kollektiven Lynchszene, in der die Eltern der ermordeten Kinder den Täter nacheinander verstümmeln, zerschneiden und erstechen. Es sind kaum auszuhaltende Bilder, verzweifelte Verschmelzungen von Trauma und Vergeltung. Doch all diese filmischen Feldzüge enden in Blut und Dreck und Grausamkeit. Im koreanischen Kino führt die Rache nie zu Genugtuung, sie ist Symptom einer Geschichte, deren Wunden immer wieder aufplatzen. Am Ende zerstört sie den Rächenden selbst.
 Daß das asiatische Kino Hollywood um Lichtjahre voraus ist, zeigt Andrew Laus und Alan Maks Trilogie „Infernal Affairs“. Mit dieser Trilogie kann nichts mithalten. „Infernal Affairs“ ist ein absoluter Kracher: er hat die besten Schauspieler, die verrückteste Choreografie und die elegantesten Anzüge. Der Hauptstrang beschreibt zwei Verräter: Ming, der von dem Gangsterboß Sam als Spitzel bei der Polizei eingeschleust wurde, und Yan, der von Inspector Wong als Spitzel bei den Triaden Dienst tut. Beide treiben dieses Spiel schon ein geraume Weile, und ein ist kristallklar, daß sie beide bald nicht mehr wissen, wer und was sie eigentlich sind. Gangster und Polizisten sind in einem Polizeirevier kurz davor, sich die Köpfe einzuschlagen. Der melancholische Inspector Wong macht mit seinem Eintreten der Szene ein Ende und einen kurzen Augenblick stehen alle still. Ruhe. Zuschauer denkt: wir haben hier zwei Sorten Polizisten, die gegeneinander arbeiten, außerdem mindestens zwei Sorten von Banditen, die gegeneinander arbeiten. Jeder dieser Polizisten hat was laufen mit einem der Banditen – im Guten oder im Schlechten. Kein Mensch auf dieser Welt, Brad Pitt und George Clooney eingeschlossen, sieht zur Zeit so natürlich und elegant in einem Anzug aus, wie diese chinesischen Schauspieler. Selbst der Streber, der Inspektor mit der Brille, sieht so unglaublich elegant aus, daß man sich in ihn nicht weniger verliebt als in Yan (der göttliche Tony Leung), der ein Huhn in den Suppentopf lächeln könnte. Das Hongkong–Kino hatte seine Glanzzeit von den von den späten 1970ern bis in die frühen 1990er Jahre. John Woo hat viel von Hollywood gelernt, er gaben dem Action–Kino aber mehr als einen neuen Dreh. In hoch virtuosen Inszenierungen mal extrem beschleunigter, mal stark verlangsamter Bewegungs– und Gewaltchoreografien erfand er dem Kino eine Kinetik, die es so noch nicht gesehen hatte. Die Produktionsbedingungen waren ganz andere, als man sie aus Hollywood kennt. In den besten Filmen gelang es, mit viel weniger Geld, in viel kürzerer Zeit, mit oft sehr wenig ausgefeilten Drehbüchern die irrsten Spektakel auf die Beine zu stellen. Stimmung und Schnitt, Schußwechsel und Blutfontänen statt plausibler Plots und tief schürfender Figurenspsychologie. Während die muskelbepackten amerikanischen Action–Helden der 80er–Jahre mit dem hochgerüsteten Plattmachen von Feinden befaßt waren, bewegten sich die Hongkong–Stars in filigranen Tänzen so rasant wie elegant durch lustvoll artifizielle Spiegelkabinette. Das ist Genre-Kino, glücklicherweise kein Meisterwerk Diese Akteure sind so smart, daß sie sich selbst ein Bein stellen. Das ist die duffte Nachricht. Wir lahmarschigen Westler haben den Anschluß noch nicht ganz verloren. Es zeigt jedoch das ganze Ausmaß von Kapitulation, daß Martin Scorsese diesen Film mit »The Departed« gecovert hat. Scorsese hat angefangen als Lehrling in der B–Movie–Fabrik des Roger Corman, dem es in erster Linie um die Kohle ging, nicht um Kunstanspruch. Bei Corman mag Scorsese das Handwerk gelernt haben, aber nicht seine Kunst. Denn es ist zum wichtigen Teil seiner Kunst geworden, die Eigenwirkung des Handwerks zu suchen und mehr zu tun, als zu tun wäre, wollte man einfach nur Geschichten erzählen oder Genre–Regeln erfüllen. Scorseses Kino ist von diesem Anfang an auf dem Weg zur Manier, zum Überbordenden, zur schieren Virtuosität eines Könnens. In „Departed “ erweist sich, daß unter diesen Vorzeichen das Remake eines Genre–Stoffs nicht gelingen kann Letztlich gemeinsam ist beiden Filmen nurmehr die spiegelsymmetrische Geschichte zweier Spitzel, von denen der eine für die Polizei bei einer Drogenbande, der andere für die Dealer bei der Polizei arbeitet. Es geht um den Verrat und seine Dialektik (die Fritz Lang mit M. jedoch wesentlich subtiler ausgelotet hat); der Gute übt Verrat an den Bösen, und der Böse übt Verrat an den Guten. Jeder der beiden Polizisten ficht seinen eigenen Vaterkomplex mit Costello aus, muß sich entscheiden zwischen Sein und Schein, zwischen Halbwelt und Heldenlicht. Beide Spitzel müssen um das Vertrauen des Drogenbosses kämpfen; der eine, weil er für ihn arbeitet, der andere, weil er gegen ihn arbeitet, aber nicht entdeckt werden darf. Das Ergebnis ist explosiv: ein Scorsese–Thriller und ein Hongkong–Actioner, in flirrender, hochkomplexer Doppelbelichtung.
Daß das asiatische Kino Hollywood um Lichtjahre voraus ist, zeigt Andrew Laus und Alan Maks Trilogie „Infernal Affairs“. Mit dieser Trilogie kann nichts mithalten. „Infernal Affairs“ ist ein absoluter Kracher: er hat die besten Schauspieler, die verrückteste Choreografie und die elegantesten Anzüge. Der Hauptstrang beschreibt zwei Verräter: Ming, der von dem Gangsterboß Sam als Spitzel bei der Polizei eingeschleust wurde, und Yan, der von Inspector Wong als Spitzel bei den Triaden Dienst tut. Beide treiben dieses Spiel schon ein geraume Weile, und ein ist kristallklar, daß sie beide bald nicht mehr wissen, wer und was sie eigentlich sind. Gangster und Polizisten sind in einem Polizeirevier kurz davor, sich die Köpfe einzuschlagen. Der melancholische Inspector Wong macht mit seinem Eintreten der Szene ein Ende und einen kurzen Augenblick stehen alle still. Ruhe. Zuschauer denkt: wir haben hier zwei Sorten Polizisten, die gegeneinander arbeiten, außerdem mindestens zwei Sorten von Banditen, die gegeneinander arbeiten. Jeder dieser Polizisten hat was laufen mit einem der Banditen – im Guten oder im Schlechten. Kein Mensch auf dieser Welt, Brad Pitt und George Clooney eingeschlossen, sieht zur Zeit so natürlich und elegant in einem Anzug aus, wie diese chinesischen Schauspieler. Selbst der Streber, der Inspektor mit der Brille, sieht so unglaublich elegant aus, daß man sich in ihn nicht weniger verliebt als in Yan (der göttliche Tony Leung), der ein Huhn in den Suppentopf lächeln könnte. Das Hongkong–Kino hatte seine Glanzzeit von den von den späten 1970ern bis in die frühen 1990er Jahre. John Woo hat viel von Hollywood gelernt, er gaben dem Action–Kino aber mehr als einen neuen Dreh. In hoch virtuosen Inszenierungen mal extrem beschleunigter, mal stark verlangsamter Bewegungs– und Gewaltchoreografien erfand er dem Kino eine Kinetik, die es so noch nicht gesehen hatte. Die Produktionsbedingungen waren ganz andere, als man sie aus Hollywood kennt. In den besten Filmen gelang es, mit viel weniger Geld, in viel kürzerer Zeit, mit oft sehr wenig ausgefeilten Drehbüchern die irrsten Spektakel auf die Beine zu stellen. Stimmung und Schnitt, Schußwechsel und Blutfontänen statt plausibler Plots und tief schürfender Figurenspsychologie. Während die muskelbepackten amerikanischen Action–Helden der 80er–Jahre mit dem hochgerüsteten Plattmachen von Feinden befaßt waren, bewegten sich die Hongkong–Stars in filigranen Tänzen so rasant wie elegant durch lustvoll artifizielle Spiegelkabinette. Das ist Genre-Kino, glücklicherweise kein Meisterwerk Diese Akteure sind so smart, daß sie sich selbst ein Bein stellen. Das ist die duffte Nachricht. Wir lahmarschigen Westler haben den Anschluß noch nicht ganz verloren. Es zeigt jedoch das ganze Ausmaß von Kapitulation, daß Martin Scorsese diesen Film mit »The Departed« gecovert hat. Scorsese hat angefangen als Lehrling in der B–Movie–Fabrik des Roger Corman, dem es in erster Linie um die Kohle ging, nicht um Kunstanspruch. Bei Corman mag Scorsese das Handwerk gelernt haben, aber nicht seine Kunst. Denn es ist zum wichtigen Teil seiner Kunst geworden, die Eigenwirkung des Handwerks zu suchen und mehr zu tun, als zu tun wäre, wollte man einfach nur Geschichten erzählen oder Genre–Regeln erfüllen. Scorseses Kino ist von diesem Anfang an auf dem Weg zur Manier, zum Überbordenden, zur schieren Virtuosität eines Könnens. In „Departed “ erweist sich, daß unter diesen Vorzeichen das Remake eines Genre–Stoffs nicht gelingen kann Letztlich gemeinsam ist beiden Filmen nurmehr die spiegelsymmetrische Geschichte zweier Spitzel, von denen der eine für die Polizei bei einer Drogenbande, der andere für die Dealer bei der Polizei arbeitet. Es geht um den Verrat und seine Dialektik (die Fritz Lang mit M. jedoch wesentlich subtiler ausgelotet hat); der Gute übt Verrat an den Bösen, und der Böse übt Verrat an den Guten. Jeder der beiden Polizisten ficht seinen eigenen Vaterkomplex mit Costello aus, muß sich entscheiden zwischen Sein und Schein, zwischen Halbwelt und Heldenlicht. Beide Spitzel müssen um das Vertrauen des Drogenbosses kämpfen; der eine, weil er für ihn arbeitet, der andere, weil er gegen ihn arbeitet, aber nicht entdeckt werden darf. Das Ergebnis ist explosiv: ein Scorsese–Thriller und ein Hongkong–Actioner, in flirrender, hochkomplexer Doppelbelichtung.
Von Babelsberg nach Bollywood
Auf dem „asiatischen Markt“ hat es Indien als weltgrößter Filmproduzent geschafft, mit einer jährlichen Produktion von fast tausend Filmen, die täglich Millionen von Zuschauern in die Kinos locken, sogar Hollywood zu überflügeln. Die bonbonfarbenen Hindifilme, mit ihren affektierten Tanz– und Gesangseinlagen und einem hocheffizienten Starsystem, werden in Indien manchmal etwas boshaft als „Opium fürs Volk“ bezeichnet. Mit ihrem ganz eigenen Stil sind die Filme inzwischen aber zu einem weltweiten Exportartikel geworden. Auch jenseits von Bollywood hat sich in Indien ein Independent–Kino entwickelt. Als ambitioniertester und herausragendster Film der letzten Jahre bleibt Suman Mukhopadhyays Debutfilm Herbert aus dem Jahr 2005 in Erinnerung. Er basiert auf einer preisgekrönten Novelle des bekannten und auf Grund seiner politisch linken Position ebenso umstrittenen Schriftstellers, Nabarun Bhattacharya. Die vielschichtige Erzählung spürt anhand der Geschichte des Außenseiters Herbert den sozialen und politischen Veränderungen Kalkuttas nach, und spannt dabei einen Bogen über fünfzig Jahre indische Geschichte. Angefangen von der britischen Kolonialherrschaft über die Dekolonisierung und die Entstehung der marxistischen Naxalit–Bewegung bis hin zur globalisierten Wirtschaft der 90er Jahre. Von der politischen St0ßrichtung erinnert das Claude Lanzmann. Sein Film Shoah“ ist eine Inkarnation, eine Fleischwerdung. Ein Experiment. Es ist ein Film aus dem Bauch und aus dem Kopf. Ein sehr physischer, ein körperlicher Film. Es ist das Instrument des Erinnerns. Aber am Anfang ging es mir keineswegs um das Erinnern, sondern um das „Unerinnerbare“ des „Unsagbaren“. Es handelt sich nicht um Erinnerungen – Erinnerungen sind schwach, man vergisst sie. Es gibt eine andere Form des Vergessens: den Wahn des Erinnerns, wie er heute wütet. Dieser museale Wahnsinn. Museen sind gut und nötig, aber sie sind Orte des Toten. Sie zeigen ein totes Wissen. Wie die Geschichtsbücher für Kinder, in denen man ihnen von der Schoa erzählt. Museen sind Instrumente der Institutionalisierung. Man kann um die Schoa und mit ihr sehr viel machen. Aber man kann nicht zeigen, wie dreitausend Menschen in der Gaskammer von Auschwitz-Birkenau sterben. Es gibt keine Fotografie, es gibt kein Bild davon. Es gibt nichts. Diese Menschen starben in der schwarzen Dunkelheit. Stumm. Darauf darf sich niemand einlassen. Das zu zeigen, das darzustellen versuchen. Niemand hat es gewagt. Spielberg hat es versucht, auf seine Art und Weise, mit Tricks und Schlichen. In den wirklichen Gaskammern hat man den Menschen, die sterben werden, gesagt, daß es zur Dusche geht. Der falsche Duschraum war eine Gaskammer. In Spielbergs Film ist es umgekehrt: Die dem Tode geweihten Menschen warten auf die Gaskammer – die ein wirklicher Duschraum ist. Das ist schon eine Verfälschung der Wirklichkeit, in der Wirklichkeit hat es sich nie so abgespielt. Es ist klar: mit der Gaskammer kann man keine Fiktion machen.
Laterna–Magica–Imagos
Das Kino des 21. Jahrhunderts findet ein Publikum vor, das mit nichtlinearen Musikvideos und DVDs aufgewachsen ist und mit dem Verfolgen seiner Filmplots keine Mühe hat. Dabei kommen zwangsläufig die Darsteller ins Hintertreffen, die beim absoluten Primat eines nur noch auf Effekte setzenden Erzählansatzes zu Anhängseln, Marionetten der Technik reduziert werden. Das Kino ist jedoch ein Ort, der dem Betrachter Zeit schenkt, ohne man etwas dafür tun muß. Hier läuft Zeit nicht einfach ab, sondern sie verhält sich. Kritiker sprechen von der „Traumfabrik“, nehmen es als Binsenweisheit, daß das Kino dem Traum nahe sei. Tatsächlich ist das Publikum an die Realismus–Konventionen des Erzählkinos gewöhnt und reagieren erstaunt–irritiert, wenn Filme einmal tief in veritable Traumlogik eintauchen. Die Surrealisten versuchten das und provozierten Skandale – Luis Buñuel etwa, mit „Un chien andalou“ (1928) und „L’age d’or“ (1930). Diesem Kino ist der kanadische Filmemacher Guy Maddin verpflichtet. Dieser Regisseur, sucht nicht den surrealistischen Schock, sondern die Traumverzauberung. Er erinnert an die früheste Kindheit der „laufenden Bilder“, an wundersam flackernde Laterna–Magica–Imagos, an expressionistische Theatralik, und mixt Stummfilmpathos in sein postmodernes Ironie–Spiel – so werden die Essenzen der Ängste und Sehnsüchte destilliert und in traumnahen Imaginationen beschworen. Guy Maddin entwirft ein eigenwilliges Universum, steigert Kitsch zu Camp, gibt das Pathos der Lächerlichkeit preis und sucht im Stimmengewirr der Zyniker, Marktschreier und selbstverliebten Theatraliker nach den Herztönen seiner Darsteller. Mit stoischem Gleichmut bringt Maddin Melodram, Tragikomödie und Farce zusammen. Wie albern sich seine Figuren in ihrem Schmerz auch aufführen – Maddin ist es ernst mit den ganz großen Gefühlen. In diesen Filmen bekommt das unter Kritikern leidlich ausgereizte Attribut „obsessiv“ eine völlig neue Qualität.
Der heilige finnische Trinker
 Als ich den schmerzhaft schönen »Juha« auf DVD wiedersah, hatte ich habe den Eindruck, daß der Stummfilm als künstlerische Form noch im Wachsen begriffen war, als ökonomische Gründe, eben die Nachfrage nach Tonfilmen, ihm ein vorzeitiges Ende bereiteten. Mit dem Stummfilm hat das Kino zu seiner stärksten Sprache gefunden. Mit dem Tonfilm hat es sich wieder am Theater orientiert und seine Bildkraft verloren. Im stummen Bild kommunizieren wie es Alfred Hitchcock von jedem modernen Filmemacher forderte – das können heute nur noch wenige. Immer wieder erliegen Regisseure der Versuchung, einen Film zu drehen, wie anno dazumal. Der einzige, der dies wirklich bis ins Letzte beherrscht, von der Materialwahl bis zur Freiheit der Imagination, ist der heilige finnische Trinker. Minimalismus und Melancholie. Rockabillys und finnischer Tango. Die Kälte der Heimat und die Sehnsucht nach der Ferne. Die Figuren leiden nicht an ihren Handlungen oder an ihrem Schicksal, sondern an inneren Dispositionen, sie können nicht anders, deshalb der Eindruck des Somnambulen. Das Kino Aki Kaurismäkis kommt von jeher mit einem Minimum an mitunter paradoxen Koordinaten aus. In seinem Filmen werden Frauenfiguren gezeigt, die ihre Weiblichkeit nicht immerzu auf dem Tablett präsentieren und rechtfertigen müssen, sondern einfach sein dürfen. Seine Filme sind von einer hintergründigen Heiterkeit geprägt, die nicht auf Pointen, sondern auf Geistesverwandtschaft aus sind. Das eigentlich Berührende seiner Filme liegt in der demonstrativen Sympathie für unhaltbare Standpunkte, sei das die eigensinnige Liebe zum cineastischen Detail oder der Stolz, eine schöne Frau auch dann nicht zu verraten, wenn die eigene Existenz auf dem Spiel steht. Kaurismäkis großes künstlerisches Projekt ist strenggenommen ein Kino, das es nicht gibt und nie gegeben hat. Ein Kino, das sich selbst erfindet, feiert und historisiert. Wie nach einer langen irrlichternden Zeitreise platzt es nun als fiktiver historischer Fund in eine Gegenwart, die sich an diese kinematografische Vergangenheit nicht erinnern kann. Vielleicht liegt es daran, daß man sich bei seiner ersten Begegnung mit dem Kaurismäkis’schen Universum wie eine eben aufgewachte Komapatientin fühlt, die Bilder und Geschichten zu sehen bekommt, die sie von irgendwo her zu kennen glaubt, um dann doch festzustellen, das sie so etwas noch nie zuvor gesehen hat. Kaurismäkis Geschichten sind wie Fieberträume. Delirierende Melodramen, die auf den ersten Blick so schwülstig sind und doch mit der nächsten Windung so zart und rührend, so grotesk und bizarr werden können, daß man meint, ihr Schöpfer müsse die REM–Phasen von Stroheim, Buñuel und Lynch mit denen von Hans Christian Andersen oder anderen kreuzunglücklichen Märchenerzählern vernetzt haben. Dazu kommt dieser wunderbare Mix aus ironischen Brechungen und heiligem Ernst, die Kaurismäkis Werk weit über den Status bloßer Kultigkeit erheben. Der Regiesonderling variiert seine Motive, läßt seine Heldinnen und Helden zum Filmabspann mal mit ein bißchen mehr, mal mit ein bißchen weniger Hoffnung in die Zukunft blicken, dreht Farbfilme, die märchenhaft, und Schwarzweissfilme, die wie die ungeschminkte Wirklichkeit aussehen, und verfaßt Skripts, deren spärliche Dialoge auf dem Etikett einer Wodkaflasche Platz finden würden. Aki Kaurismäki kennt das Leben, von dem seine Filme erzählen, das Elend aber bildet er nicht einfach ab – er leuchtet es aus mit nostalgischen Farben und stilisiert es in stummfilmhaften Arrangements. Denn für ihn, der seine utopische Seele hinter scharfkantiger Lakonie und pochendem Weltschmerz verbirgt, ist die prekäre Tristesse der Randständigen eine Welt voller Schönheit: wahrhaftig und frei von Gier. Seinen Figuren verleiht er daher grimmigen Glamour, indem er sie ausstattet mit Überbleibseln der Film– und Popgeschichte: der Cadillac, die Rocksongs, das verkratzte Kofferradio. Kaurismäkis Helden ringen um einen Nischenplatz, und sie sagen: Ich bin zäh, und ich habe Stil. „Wenn du Stil hast, dann bewahre ihn dir“, sagte Kaurismäki bei den Filmfestspielen in Locarno, als man sein Lebenswerk ehrte. „Bewahre ihn, denn es ist das Einzige, was du hast.“ Das finnische Wort für Sprache ist „puhe“. Es leitet sich von „puhaltaa“ ab, dem finnischen Wort für blasen. In Finnland bedeutet Sprechen: Luft in die Atmosphäre blasen. Es ist ein weites Land mit relativ wenigen Menschen. Man kennt sich nicht. Was also hätte man sich schon großartig zu sagen?
Als ich den schmerzhaft schönen »Juha« auf DVD wiedersah, hatte ich habe den Eindruck, daß der Stummfilm als künstlerische Form noch im Wachsen begriffen war, als ökonomische Gründe, eben die Nachfrage nach Tonfilmen, ihm ein vorzeitiges Ende bereiteten. Mit dem Stummfilm hat das Kino zu seiner stärksten Sprache gefunden. Mit dem Tonfilm hat es sich wieder am Theater orientiert und seine Bildkraft verloren. Im stummen Bild kommunizieren wie es Alfred Hitchcock von jedem modernen Filmemacher forderte – das können heute nur noch wenige. Immer wieder erliegen Regisseure der Versuchung, einen Film zu drehen, wie anno dazumal. Der einzige, der dies wirklich bis ins Letzte beherrscht, von der Materialwahl bis zur Freiheit der Imagination, ist der heilige finnische Trinker. Minimalismus und Melancholie. Rockabillys und finnischer Tango. Die Kälte der Heimat und die Sehnsucht nach der Ferne. Die Figuren leiden nicht an ihren Handlungen oder an ihrem Schicksal, sondern an inneren Dispositionen, sie können nicht anders, deshalb der Eindruck des Somnambulen. Das Kino Aki Kaurismäkis kommt von jeher mit einem Minimum an mitunter paradoxen Koordinaten aus. In seinem Filmen werden Frauenfiguren gezeigt, die ihre Weiblichkeit nicht immerzu auf dem Tablett präsentieren und rechtfertigen müssen, sondern einfach sein dürfen. Seine Filme sind von einer hintergründigen Heiterkeit geprägt, die nicht auf Pointen, sondern auf Geistesverwandtschaft aus sind. Das eigentlich Berührende seiner Filme liegt in der demonstrativen Sympathie für unhaltbare Standpunkte, sei das die eigensinnige Liebe zum cineastischen Detail oder der Stolz, eine schöne Frau auch dann nicht zu verraten, wenn die eigene Existenz auf dem Spiel steht. Kaurismäkis großes künstlerisches Projekt ist strenggenommen ein Kino, das es nicht gibt und nie gegeben hat. Ein Kino, das sich selbst erfindet, feiert und historisiert. Wie nach einer langen irrlichternden Zeitreise platzt es nun als fiktiver historischer Fund in eine Gegenwart, die sich an diese kinematografische Vergangenheit nicht erinnern kann. Vielleicht liegt es daran, daß man sich bei seiner ersten Begegnung mit dem Kaurismäkis’schen Universum wie eine eben aufgewachte Komapatientin fühlt, die Bilder und Geschichten zu sehen bekommt, die sie von irgendwo her zu kennen glaubt, um dann doch festzustellen, das sie so etwas noch nie zuvor gesehen hat. Kaurismäkis Geschichten sind wie Fieberträume. Delirierende Melodramen, die auf den ersten Blick so schwülstig sind und doch mit der nächsten Windung so zart und rührend, so grotesk und bizarr werden können, daß man meint, ihr Schöpfer müsse die REM–Phasen von Stroheim, Buñuel und Lynch mit denen von Hans Christian Andersen oder anderen kreuzunglücklichen Märchenerzählern vernetzt haben. Dazu kommt dieser wunderbare Mix aus ironischen Brechungen und heiligem Ernst, die Kaurismäkis Werk weit über den Status bloßer Kultigkeit erheben. Der Regiesonderling variiert seine Motive, läßt seine Heldinnen und Helden zum Filmabspann mal mit ein bißchen mehr, mal mit ein bißchen weniger Hoffnung in die Zukunft blicken, dreht Farbfilme, die märchenhaft, und Schwarzweissfilme, die wie die ungeschminkte Wirklichkeit aussehen, und verfaßt Skripts, deren spärliche Dialoge auf dem Etikett einer Wodkaflasche Platz finden würden. Aki Kaurismäki kennt das Leben, von dem seine Filme erzählen, das Elend aber bildet er nicht einfach ab – er leuchtet es aus mit nostalgischen Farben und stilisiert es in stummfilmhaften Arrangements. Denn für ihn, der seine utopische Seele hinter scharfkantiger Lakonie und pochendem Weltschmerz verbirgt, ist die prekäre Tristesse der Randständigen eine Welt voller Schönheit: wahrhaftig und frei von Gier. Seinen Figuren verleiht er daher grimmigen Glamour, indem er sie ausstattet mit Überbleibseln der Film– und Popgeschichte: der Cadillac, die Rocksongs, das verkratzte Kofferradio. Kaurismäkis Helden ringen um einen Nischenplatz, und sie sagen: Ich bin zäh, und ich habe Stil. „Wenn du Stil hast, dann bewahre ihn dir“, sagte Kaurismäki bei den Filmfestspielen in Locarno, als man sein Lebenswerk ehrte. „Bewahre ihn, denn es ist das Einzige, was du hast.“ Das finnische Wort für Sprache ist „puhe“. Es leitet sich von „puhaltaa“ ab, dem finnischen Wort für blasen. In Finnland bedeutet Sprechen: Luft in die Atmosphäre blasen. Es ist ein weites Land mit relativ wenigen Menschen. Man kennt sich nicht. Was also hätte man sich schon großartig zu sagen?
Leicht angedeutete Erzählung
Während Béla Balázs die Authentizität des Films noch als adäquate Antwort auf die Abstraktionen der Sprache pries und Rudolf Arnheim sich im Namen der Kunst der filmischen Konfektionsarbeit widersetzte, konnte die Filmwissenschaft um Christian Metz dem Stereotyp unter dem Einfluß der Semiotik bald auch ein positiv gefärbtes Interesse entgegenbringen. Wieweit dieser Paradigmenwechsel tatsächlich durch die massive kulturelle Präsenz des kulturindustriellen Mediums Film forciert worden ist – und nicht einem tiefer reichenden, generellen Wandel in der Beobachtung der Wirklichkeit entspricht –, ist diskutabel. Unumstritten sind die Perspektiven, die der ästhetischen Bereich verspricht: Wenn sich das Stereotyp als eine mögliche Variante pikturaler Traditionen begreifen läßt, prägt es auch jene heterogenen und teilweise disparaten Spannungsmomente mit, die es dem Film erlauben, Anspruch auf Kunststatus zu erheben. In seiner Theorie des Films schwärmte Kracauer von der „leicht angedeuteten Erzählung“, die sich wie von selbst aus dem mit der Kamera aufgezeichneten Leben schält. Sein bevorzugter Leinwandheld war Nanook, der Eskimo, der sich in Robert Flahertys gleichnamigem Klassiker selbst verkörperte. Das hat er mit den meisten Darstellern der so genannten Berliner Schule gemeinsam.
Geist des Schauplatzes
Die „Berliner Schule“ ist im deutschen Film ein feststehender Begriff, auch wenn ihre Mitglieder ihn nicht gerne hören, weil er nach Hausaufgaben, Klassenarbeit und Nachsitzen klingt. Realität ist ihr Schlüsselwort, wenn auch nicht jene, die man mit wackligen Handkameras in den Straßen einfängt. Das unterscheidet sie vom Dogma–Vitalismus; vom kommerziellen Autorenkino der X–Filmer trennen sie Meilen und Lichtjahre gar von Eichingers Populismus. Allen gemeinsam ist ein spürbarer „Geist des Schauplatzes“, sei es das Berlins neue Mitte in »Gespenster« von Petzold oder das brandenburgische Dorf in Grisebachs »Sehnsucht«. Bei ihr geht es, wie häufig bei der Berliner Schule, „nur“ um die Grundzelle der Gesellschaft, die Familie, und die Zentrifugalkräfte, die an ihr zerren. Das definierende Merkmal ist die Beiläufigkeit, mit der Höchstdramatisches präsentiert wird. Der Selbstmordversuch in Grisebachs »Sehnsucht« etwa, auf den fröhlich plappernde Kinder folgen. Diese Filmemacher haben ein verschärftes Gespür für Originaltöne, eine Nüchternheit im Erzählen, die man nicht mit Kälte verwechseln darf, und eine Abneigung gegen jenes Gefühlskino, das überall im Land die Kassen füllt und die Herzen wärmt. Will man die Berliner Schule verorten, dann am ehesten in der Nähe der zweiten Nouvelle Vague Frankreichs, von Jean Eustache, Philippe Garrel, Maurice Pialat. Es war die Epoche, in der das Kino für etwas anderes da war. Zum Beispiel, indem es sich gegen Verbote durchsetzte, weil es ihm nur auf diese Weise möglich war, eine Projektion der Welt in einem gegebenen Augenblick zu sein. Allein aus diesem Grund hat die Nouvelle Vague das Recht gefordert, auf den Pariser Straßen zu drehen. Diese Autoren wollten gegen die Regeln arbeiten, aber ohne neue Regeln zu erfinden. Die Politik der Autoren der Nouvelle Vague bestand ja nur darin, den Beitrag des Regisseurs als eines Bilderschöpfers gegenüber dem Drehbuchautor anzuerkennen. Es ging darum, die Grammatik des Kinos als eigenständige visuelle Grammatik zu behandeln und zu retten, so wie sie von manchen Stummfilmregisseuren, etwa Griffith, erfunden worden war. Es ist eine Grammatik des Bildererzählens, die sich fortwährend erneuern muss, gegen die Stereotypen und die Routine. Die Berliner Schule teilt die Überzeugung, daß gesellschaftlicher Wandel nottut, aber gleichzeitig die Erfahrung des Scheiterns ihrer politischen Utopien. Sie sucht nach Zeichen der Veränderung, aber nicht im Makro–, sondern im Mikrokosmos des Familien–, Freundes– oder Arbeitskreises. Die Berliner Schüler sind keine Polemiker, sondern Beobachter, und sie nehmen Realität nicht unter ihre Lupe, sie zu reproduzieren oder ironisieren oder psychologisieren, sondern um sie in eine Künstlichkeit zu überführen, welche Wirklichkeit so lange siebt, bis sie ihre reinstmögliche Form erreicht hat. Als Sieb dient die Reduktion; es wird wenig geredet und ohne expressive Gesten gespielt und nicht wild geschnitten. Diese Autorenfilmer scheuen die manipulativen Möglichkeiten ihres Handwerkszeugs, einem Ethnologen ähnlich, der sich unsichtbar wünscht, damit seine Präsenz das Forschungsergebnis nicht verfälsche. Denn: Die Wahrheit hinter dem Alltäglichen werde sich schon decouvrieren, lauere man ihr nur hartnäckig genug auf.
Serge Daney beschrieb schon Ende der siebziger Jahre, wie das Filmbild von etwas Visuellem abgelöst wird. Durch den Siegeszug der DVD, sind die Konsequenzen viel deutlicher erkennbar, erst recht durch das Verhalten der Verleiher, die versuchen sich auf Kosten der Kinos von der derzeitigen Krise schadlos zu halten. Die Kinoauswertung eines Films wird immer kürzer, der Vertrieb läuft immer stärker über DVD. Und das ist nur der Anfang. Die DVD ist wahrscheinlich nur eine Übergangsform hin zu einer datenträgerlosen individuellen Auswertung. Was passiert mit dem Film, wenn ich ihn aus dem Kino, der Kollektivrezeption herausnehme und in den privaten Raum versetze? Er wird mittels Pausenmöglichkeit, Vorspulen, Überspringen einem individuellen Zeitbedürfnis und Zugriff unterworfen, der schon das vom Fernsehen her vertraute Zapping regiert. Der Film wird in dem Moment ein anderer sein, wenn man ihn, allein im privaten Raum, manipulieren und unterbrechen kann, statt im Kino, in diesem dunklen Raum, zu einer Wahrnehmung gezwungen zu sein, die nicht die eigene ist.
Seit einiger Zeit bringt der Filmkritiker Enno Patalas wissenschaftliche DVD–Editionen von Klassikern wie „Metropolis“ oder „Panzerkreuzer Potemkin“ heraus. Man kann, während man den Film schaut, zugreifen auf Fussnoten, sehen und hören, was Filmmusikkomponisten oder Production–Designer sich bei ihrer Arbeit dachten. Patalas betont, keinerlei Probleme mit dieser Art des den Filmfluß brechenden Zugriffs zu haben, weil sowieso jeder einen eigenen Film sähe und von Filmen viele Versionen existierten, nicht die eine gültige.
Heimkino
Mit Sicherheit kann die DVD dazu beitragen, alten, unzugänglichen Filmen neue Sichtbarkeit zu verleihen. Beschädigt wird aber die Rezeption des Films. Jean Louis Schefer sagt, ein Film sei nicht Gegenstand von Denken, sondern selber ein Denken. Das Originäre am Kino ist, daß dieses andere Denken sich an ein Kollektiv richtet, das zur Betrachtung gezwungen ist. Dieses andere, alternative Leben, das ihm der Film zu bieten hatte, das erschloß sich ihm allein durch das Kino, daß ihm keine Wahl ließ. Dadurch, daß ich den Film in ein manipulierbares Derivat, eine DVD oder ähnliches, übersetze, wird die Kollektivrezeption mit weit reichenden Folgen zum Verschwinden gebracht. Selbst wenn man Walter Benjamins Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ heute mit kritischem Abstand betrachtet, so muß man doch feststellen, daß er Kino nicht lediglich als ästhetisches, sondern als gesellschaftliches und politisches Phänomen versteht. Das neue Medium ermöglicht neue Wahrnehmungsformen und ist daher „fortschrittlich“.
Ihre Verknüpfung von Kino und politischer Bewußtseinsbildung überrascht. Bei seinem Aufkommen ist der Kinozuschauer von intellektueller Seite als ein still gestellter, passiver Konsument gesehen worden. Die Vita Contemplativa, lange Zeit Privileg des Adels, das Zeit haben für Betrachtung und Reflexion, fällt den Massen zu. Nur, daß sie es auf analyseferne, oberflächliche Art praktizieren.
In den ersten Jahrzehnten der Filmtheorie war man sich zumindest darin einig, daß das Kino einen radikalen Angriff auf die klassischen Künste darstellt. Als einer der ersten erkannte Benjamin, welch gewaltiges gesellschaftliches Potential darin steckt, daß das Kino geeignet war, der Wirklichkeit ihren Kultstatus zu nehmen. Die Passivität und Zerstreuung des Kinozuschauers, dieses Sich–Ausliefern an ein anderes Denken, ist eine wirklich neue, bis heute einzigartige, kritische und vielleicht auch politische Form der Wahrnehmung. Das Subjekt vor einem DVD Player ist das gleiche wie das politische Subjekt der westlichen Demokratien, das alle vier, fünf Jahre sein Kreuz machen darf. Das ist eine Wahl, die eigentlich keine ist, eine Öffentlichkeit, die keine mehr ist.
Was aktuell im Internet an Gemeinschafts–Phänomenen zu beobachten ist, versucht individuellen Anliegen und Bedürfnissen nach Kommunikation zu entsprechen; das ist gut und wichtig, aber auch ein wenig exhibitionistisch. Auch in den prominenten Foren wie Youtube trifft der Befund zu, daß mir eine Wahl mehr suggeriert wird, als daß sie stattfindet. Ständig geht es bloß darum, Best–Of–Listen von allem Möglichen zu erstellen. Vergleicht man das mit der kinospezifischen Kollektivrezeption, in der man sich einer Wahrnehmung ausliefert, dann wird hier das Subjekt reduziert auf eine entpolitisierte Form der Teilnahme.
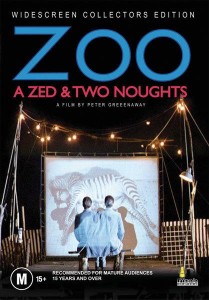 Wie für Oper und Theater sind für das Kino gesellschaftliche Schutzräume zu organisieren, Zoos, Museen für Kunstformen, unterdrückte, verdrängte, Wahrnehmungen, Sehnsüchte, Gerechtigkeitsforderungen, die dort, einigermaßen in Ruhe gelassen von Antrieben des Marktes, einen Ort haben. Das hieße zugleich, unsere Gegenwart, von neuen Filmen verhandelt, würde direkt ins Museum gestellt. Mit der Musealisierung geht natürlich immer die Gefahr einher, daß Kunst ihre gesellschaftliche Notwendigkeit verliert. Deshalb halte ich Festivals für eine großartige Möglichkeit, die Musealisierung des Kinos zu verhindern, wie es auch gängige Theaterpraxis gegenüber den Texten sein sollte. Es ist wichtig, soziale Räume zu bewahren, in denen eine abweichende Wahrnehmung von Realität möglich bleibt. Wir müssen an den Ursprung des Kinos zurückgegangen, wo es vor allem darum geht, Räume aufzutun und zu erkunden. Menschen, die sich in modernen Stadtlandschaften verlieren, in Straßenschluchten oder in den leeren künstlichen Kommunikationsforen. Lange Korridore, in denen Türen sich auftun in unbewohnbare Räume. Umzugskartons an der Wand, eine kantige Couch, davor ein Videospieler, in den August die alten Kassetten einschiebt, auf denen die gemeinsame Jugend dokumentiert ist. Eine Kommune-Zeit, da Gemeinschaft möglich war und Anarchie.
Wie für Oper und Theater sind für das Kino gesellschaftliche Schutzräume zu organisieren, Zoos, Museen für Kunstformen, unterdrückte, verdrängte, Wahrnehmungen, Sehnsüchte, Gerechtigkeitsforderungen, die dort, einigermaßen in Ruhe gelassen von Antrieben des Marktes, einen Ort haben. Das hieße zugleich, unsere Gegenwart, von neuen Filmen verhandelt, würde direkt ins Museum gestellt. Mit der Musealisierung geht natürlich immer die Gefahr einher, daß Kunst ihre gesellschaftliche Notwendigkeit verliert. Deshalb halte ich Festivals für eine großartige Möglichkeit, die Musealisierung des Kinos zu verhindern, wie es auch gängige Theaterpraxis gegenüber den Texten sein sollte. Es ist wichtig, soziale Räume zu bewahren, in denen eine abweichende Wahrnehmung von Realität möglich bleibt. Wir müssen an den Ursprung des Kinos zurückgegangen, wo es vor allem darum geht, Räume aufzutun und zu erkunden. Menschen, die sich in modernen Stadtlandschaften verlieren, in Straßenschluchten oder in den leeren künstlichen Kommunikationsforen. Lange Korridore, in denen Türen sich auftun in unbewohnbare Räume. Umzugskartons an der Wand, eine kantige Couch, davor ein Videospieler, in den August die alten Kassetten einschiebt, auf denen die gemeinsame Jugend dokumentiert ist. Eine Kommune-Zeit, da Gemeinschaft möglich war und Anarchie.
Letztens sah ich eine DVD über Kamelrennen, eine in vielen arabischen Staaten beliebte Sportart. Bislang waren die Jockeys Kinder, doch weil das mittlerweile verboten ist, wurden Reitroboter gezüchtet, nur 30 Kilo schwer, per Funk zu bedienen. Die Kamele aber waren mißtrauisch, buckelten und scheuten. Erst als die Maschinen wie Menschen wirkten, als sie dunkle Gesichter bekamen, eine Stimme und man ihnen künstlichen Schweißgeruch aufsprühte, ließen sich die Kamele täuschen. Wir sehen den Film, sehen den Roboter, und irgendwann sehen wir – die Kamele sind wir.
***
 Im September 2023 veröffentlichte Wolfgang M. Schmitt Die Filmanalyse: Kino anders gedacht, welches Transkripte von 120 Filmanalysen des YouTube-Formates als Text enthält.
Im September 2023 veröffentlichte Wolfgang M. Schmitt Die Filmanalyse: Kino anders gedacht, welches Transkripte von 120 Filmanalysen des YouTube-Formates als Text enthält.
→ KUNO empfielt die Wiederveröffentlichung des multi character form-Klassikers auf DVD.
Weiterführend → Zu Beginn des Essayjahres machte sich Holger Benkel gedanken über das denken.
→ In 2013 unternahm Constanze Schmidt essayistische Gedankenspaziergänge.
→ Gleichfalls in 2013 versuchte KUNO mit Essays mehr Licht ins Dasein zu bringen.
→ In 2003 stellte KUNO den Essay als Versuchsanordnung vor.
