Heinz Küpper. Nicht bloß eine Wahrnehmung
 Das literarische Werk Heinz Küppers, das seit den 1990er Jahren vom Verlag Landpresse resp. Verlag Ralf Liebe betreut wird und zum Teil neu herausgegeben wurde, nachdem einige Romane viele Jahre lang vergriffen waren, verdient unbedingt mehr Aufmerksamkeit, als ihm zuteil wird. Heinz Küpper war ein Schriftsteller, der Romane mit geschichts- und gesellschaftskritischer Grundierung schrieb, deren Merkmale feinkörnige, sensible Beobachtung, subtile Ironie und spannende Handlung sind. Die Geschichten werden bisweilen durch einen Kriminalfall in Bewegung gesetzt und befassen sich in erster Linie mit Einzelschicksalen innerhalb der dunklen und rätselhaften deutschen Geschichte seit 1933. »Simplicius 45« (1963, 1997), »Milch und Honig« (1965), »Wohin mit dem Kopf« (1986, 1998), »Zweikampf mit Rotwild« (1996), »Hermann Rohr und andere« (1998) sowie »Der Zaungast« (2002) sind wie »Seelenämter« (2000) kraft- und temperamentvoll, wort-, detail- und episodenreich in klar und komplex strukturierten, geschmeidigen Satzgefügen erzählt – mit einem Humor, der so trocken sein kann wie Euskirchener Begräbniskuchen. Da fliegen, wenn nötig, heftig die Fetzen, da kracht es, wenn nötig, gewaltig im Gebälk.
Das literarische Werk Heinz Küppers, das seit den 1990er Jahren vom Verlag Landpresse resp. Verlag Ralf Liebe betreut wird und zum Teil neu herausgegeben wurde, nachdem einige Romane viele Jahre lang vergriffen waren, verdient unbedingt mehr Aufmerksamkeit, als ihm zuteil wird. Heinz Küpper war ein Schriftsteller, der Romane mit geschichts- und gesellschaftskritischer Grundierung schrieb, deren Merkmale feinkörnige, sensible Beobachtung, subtile Ironie und spannende Handlung sind. Die Geschichten werden bisweilen durch einen Kriminalfall in Bewegung gesetzt und befassen sich in erster Linie mit Einzelschicksalen innerhalb der dunklen und rätselhaften deutschen Geschichte seit 1933. »Simplicius 45« (1963, 1997), »Milch und Honig« (1965), »Wohin mit dem Kopf« (1986, 1998), »Zweikampf mit Rotwild« (1996), »Hermann Rohr und andere« (1998) sowie »Der Zaungast« (2002) sind wie »Seelenämter« (2000) kraft- und temperamentvoll, wort-, detail- und episodenreich in klar und komplex strukturierten, geschmeidigen Satzgefügen erzählt – mit einem Humor, der so trocken sein kann wie Euskirchener Begräbniskuchen. Da fliegen, wenn nötig, heftig die Fetzen, da kracht es, wenn nötig, gewaltig im Gebälk.
Kiesel & Kastanie ∙ S. 23
In Rudeln …
Möglicherweise liege ich mit den sich anschließenden Bemerkungen zur Literatur, zur Sprache, zu Heinz Küpper sowie einigen anderen Personen und Phänomenen ›haarscharf‹, vielleicht sogar ›meilenweit‹ daneben. Vielleicht aber auch treffen die Worte, die Wörter mitunter des Pudels Kern. Oder sollte ich besser schreiben: ›meine‹ Worte, ›meine‹ Wörter? Können Worte, Wörter ›mein‹ sein? Sodann: ›Kern‹? Im Kern geht es beim Sprechen, Schreiben oder Schweigen, angeblich, um ›Wahrheit‹ oder deren Unterdrückung, Verschleierung. Ist das ›wahrhaftig‹ so? Freimütig gestehe ich: Ich weiß es nicht und weiche schon wieder ins Wortspiel aus. Enough. Enough now.
Wie unscharf ich spreche und schreibe: kein Vergleich mit den bisweilen so eifelbergbachwasserklaren Gedanken, die das Gehirn durchströmen, wenn ich an die Dinge denke, die gerne von mir bedacht sein wollen. Die Wörter, was sind die ›Wörter‹? Wo treffen sie wirklich einmal? Sobald sie in Rudeln auftreten, das kennen wir vom menschlichen Geschlecht, verblassen sie vollends, gehen in der Masse unter. »Du flüchtest in Redensarten und Metaphern: gleich im ersten Satz schon dreimal«, gibt Kraus zu bedenken, und auch ich lege die Stirn in Falten.
Küpper liest
 Heinz Küpper (1930–2005), Autor mit kerniger Sprache, ist immer bei mir. Dem war nicht immer so. Heinz Küpper erlebe ich erstmals am 20. Oktober 1994 in dem malerischen Eifeldorf Nideggen, genauer gesagt auf der Burg Nideggen, wohin der Rhein-Eifel-Mosel Verlag (mit Sitz in Pulheim bei Köln) eingeladen hat, um den von Jochen Arlt herausgegebenen Sammelband Leben – alle Tage. 2. Eifel-Lesebuch vorzustellen. Bis zu jenem Tag habe ich natürlich oft von Heinz Küpper gehört oder sporadisch etwas über ihn gelesen, aber ich kenne keinen Roman, keine Erzählung, nicht einmal einen der vier im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Filme, zu denen er die Drehbücher verfaßt hat. Oder doch? Ich erinnere mich nicht. Jedenfalls: Küpper liest und liest und liest und liest. Neben sieben weiteren Autoren gehöre auch ich zu denen, die eingeladen sind, Zeilen und/oder Verse vorzutragen. Küpper aber hat die Mitstreiter offenbar völlig vergessen, während er mit einschläfernder Stimme immer noch liest und liest. Ich hingegen werde niemals den Groll vergessen, den ich an jenem Abend gegen diesen Menschen hege, und als ich kürzlich vom ersten Satz weg die von Küpper in Nideggen gelesene Geschichte Polen wiedererkenne, die den Band Hermann Rohr und andere. Erzählungen vom Rand der Biographie einleitet, lächle ich versonnen vor mich hin und denke: Traurig, daß Heinz Küpper tot ist. Was für ein großer Schriftsteller. Es ist nicht das erste Mal, daß ich das denke, denn nach jenem Nideggener Abend lese ich nach und nach (bis auf einen) alle Romane dieses knorrigen Küpper, der sich als Autor nie beirren und sich also auch in Nideggen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Nein, Küpper zog ›sein‹ Ding durch, und das Publikum saß und schwieg.
Heinz Küpper (1930–2005), Autor mit kerniger Sprache, ist immer bei mir. Dem war nicht immer so. Heinz Küpper erlebe ich erstmals am 20. Oktober 1994 in dem malerischen Eifeldorf Nideggen, genauer gesagt auf der Burg Nideggen, wohin der Rhein-Eifel-Mosel Verlag (mit Sitz in Pulheim bei Köln) eingeladen hat, um den von Jochen Arlt herausgegebenen Sammelband Leben – alle Tage. 2. Eifel-Lesebuch vorzustellen. Bis zu jenem Tag habe ich natürlich oft von Heinz Küpper gehört oder sporadisch etwas über ihn gelesen, aber ich kenne keinen Roman, keine Erzählung, nicht einmal einen der vier im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Filme, zu denen er die Drehbücher verfaßt hat. Oder doch? Ich erinnere mich nicht. Jedenfalls: Küpper liest und liest und liest und liest. Neben sieben weiteren Autoren gehöre auch ich zu denen, die eingeladen sind, Zeilen und/oder Verse vorzutragen. Küpper aber hat die Mitstreiter offenbar völlig vergessen, während er mit einschläfernder Stimme immer noch liest und liest. Ich hingegen werde niemals den Groll vergessen, den ich an jenem Abend gegen diesen Menschen hege, und als ich kürzlich vom ersten Satz weg die von Küpper in Nideggen gelesene Geschichte Polen wiedererkenne, die den Band Hermann Rohr und andere. Erzählungen vom Rand der Biographie einleitet, lächle ich versonnen vor mich hin und denke: Traurig, daß Heinz Küpper tot ist. Was für ein großer Schriftsteller. Es ist nicht das erste Mal, daß ich das denke, denn nach jenem Nideggener Abend lese ich nach und nach (bis auf einen) alle Romane dieses knorrigen Küpper, der sich als Autor nie beirren und sich also auch in Nideggen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Nein, Küpper zog ›sein‹ Ding durch, und das Publikum saß und schwieg.
Mut zur Lücke
 Lebenslänglich habe ich mich mit Vorliebe in die fact and fiction verschmelzenden Bücher der schönen Literatur versenkt, je tiefer, um so besser, je öfter, um so lieber, habe sie geschlürft wie Milch mit Honig. (Reich bin ich durch ich weiß nicht was, / man liest ein Buch und liegt im Gras. Das erlaube ich mir mit den Worten Robert Walsers auszusprechen, denn so war das, und so ist das. Robert Walser? Wer hat ihn zu Lebzeiten zur Kenntnis genommen, gar gelesen? Den Fall Hölderlin gibt’s nicht nur einmal.) Nach und nach hat das zu einer nicht unbeträchtlichen Sammlung geführt, die ich ein paar Zeilen lang aus dem Blickwinkel der Lücke, zu der mir ›grundsätzlich‹ der Mut fehlt, wie Bensch immer mal gern anmerkt, betrachten will. (Vor wenigen Sekunden habe ich noch keine Ahnung, daß ich diesen Gedanken in diesem Satz so und nicht anders formulieren werde. Es ist wie immer, wenn ich schreibe: Ich bereite das zu behandelnde Thema in der Regel lange vor: tage-, wochen-, monatelang. Im vorliegenden Fall sind es – mindestens – einige Wochen. Sobald ich mit dem Schreiben beginne, verflüchtigt sich die Mehrzahl der vorausgedachten Formulierungen, verneigt sich (demütig, ehrfürchtig, furchtsam?) vor der sich kolossal breitmachenden Gegenwart, die ich selten stärker empfinde als in solchen Augenblicken. Alles verblaßt, und vertraute Menschen, die den Raum betreten, werden zu Fremden, zu Störenfrieden, denen ich kaum einen Blick zuwerfe, wo wir doch einem Hund, der uns jammervoll anblickt, wenigstens einen Knochen hinwerfen.)
Lebenslänglich habe ich mich mit Vorliebe in die fact and fiction verschmelzenden Bücher der schönen Literatur versenkt, je tiefer, um so besser, je öfter, um so lieber, habe sie geschlürft wie Milch mit Honig. (Reich bin ich durch ich weiß nicht was, / man liest ein Buch und liegt im Gras. Das erlaube ich mir mit den Worten Robert Walsers auszusprechen, denn so war das, und so ist das. Robert Walser? Wer hat ihn zu Lebzeiten zur Kenntnis genommen, gar gelesen? Den Fall Hölderlin gibt’s nicht nur einmal.) Nach und nach hat das zu einer nicht unbeträchtlichen Sammlung geführt, die ich ein paar Zeilen lang aus dem Blickwinkel der Lücke, zu der mir ›grundsätzlich‹ der Mut fehlt, wie Bensch immer mal gern anmerkt, betrachten will. (Vor wenigen Sekunden habe ich noch keine Ahnung, daß ich diesen Gedanken in diesem Satz so und nicht anders formulieren werde. Es ist wie immer, wenn ich schreibe: Ich bereite das zu behandelnde Thema in der Regel lange vor: tage-, wochen-, monatelang. Im vorliegenden Fall sind es – mindestens – einige Wochen. Sobald ich mit dem Schreiben beginne, verflüchtigt sich die Mehrzahl der vorausgedachten Formulierungen, verneigt sich (demütig, ehrfürchtig, furchtsam?) vor der sich kolossal breitmachenden Gegenwart, die ich selten stärker empfinde als in solchen Augenblicken. Alles verblaßt, und vertraute Menschen, die den Raum betreten, werden zu Fremden, zu Störenfrieden, denen ich kaum einen Blick zuwerfe, wo wir doch einem Hund, der uns jammervoll anblickt, wenigstens einen Knochen hinwerfen.)

Ja, ja
Bis 1994 sind die Bücher Heinz Küppers für mich gleichsam unbeschriebene Blätter. In diesem Fall ist mir, im Gegensatz zu vielen anderen Fällen, keineswegs bewußt, was ich versäume. Ich kenne den Namen natürlich, aber da ich keine Tageszeitung lese, bekomme ich nur gelegentlich und am Rande etwas mit, was mit Heinz Küpper in Zusammenhang steht, wenn etwa der Wochenspiegel einen Hinweis oder gar einen Bericht bringt. Ja, ja, habe ich wohl immer wieder gedacht, was dieser schriftstellernde Deutschlehrer aus Bad Münstereifel, der einst in Bonn und Berlin Germanistik und Geschichte studierte, schon schreiben mag. Wird schon nich so doll sein. Und so lese ich weiter unbekümmert meine/n Alfred Andersch (den Roman Winterspelt zähle ich zu den stärksten Büchern, deren Ort der Handlung die Eifel ist), Jurek Becker, Elias Canetti, Eva Demski, Gisela Elsner, Hubert Fichte, Harald Gröhler, Ernst Herhaus, Franz Innerhofer, Uwe Johnson, August Kühn, Hans Lebert, Klaus Modick, Hans Erich Nossack, Hanns-Josef Ortheil, Heinz Piontek, Michael Roes, Jochen Schimmang, Uwe Timm, Bernward Vesper, Dieter Wellershoff und Michael Zeller, nicht ahnend, was ich verpasse, indem ich auf die Lektüre der Bücher von Heinz Küpper pfeife.
Alles und nichts
Ich enge literarische Phänomene nicht gern mit Begriffen wie ›experimentelle Prosa‹, ›Naturgedicht‹, ›Liebesroman‹ oder ›Popliteratur‹ ein. (Herrliches Paradoxon: Soeben verwende ich sie.) Viele dieser Begriffe stimmen hinten und vorne nicht, sagen alles und gar nichts und klammern Entscheidendes aus. Manchem Autor, den man in diese oder jene dieser Schubladen steckte, wurde das regelrecht zum Verhängnis. Trotzdem – nun suche ich tapsend, tastend nach ersten Annäherungen, die Prosa Küppers zu umschreiben und bediene mich notwendigerweise für ein paar Augenblicke eines solchen Konstrukts: ›Provinzliteratur‹.
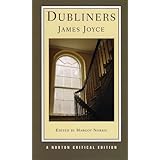 »Sind Heinz Küppers Bücher ›Provinzliteratur‹?« fragt Kraus lauernd, und ich antworte geschwind und nehme ihm (für den Moment jedenfalls …) den Wind aus den Segeln: »O ja, sehr gute sogar!« Dubliners von James Joyce, Deutschstunde von Siegfried Lenz, Die Blechtrommel von Günter Grass fallen mir, pars pro toto, als herausragende Beispiele ein, wenn ich den Begriff ›Provinzliteratur‹ denke. Viele große Romane der Weltliteratur sind Provinzliteratur. (›Provinzliteratur‹ ist seit etlichen Jahren im Literaturbetrieb ›in‹. Das hat mit dazu geführt, daß Norbert Scheuers schöne Literatur aus der Eifel im Feuilleton gerühmt und regelmäßig mit gut dotieren Preisen bedacht wird. Auf diese Weise ist Kall/Eifel zum literarischen Markenbegriff geworden. Jeden Leser, der diesen Prosaband noch nicht gelesen hat, möchte ich ermuntern, das demnächst einmal zu tun. Ein gut strukturiertes, schroffes Stück Literatur, dessen literarische Qualität im 2009 erschienenen Roman Überm Rauschen noch einmal bestätigt wird. Den Gedichtband Ein Echo von allem, dem ich in Ohne Punkt & Komma. Lyrik in den 90er Jahren, viele Seiten gewidmet habe, empfehle ich im selben Atemzug.) Der in Berlin ansässige Autor und Übersetzer Stefan Monhardt schreibt als Reaktion auf die Lektüre von Aus dem Hinterland. Lyrik nach 2000: »Provinz und Hinterland sind überall. Auch und gerade in Berlin.« So hat Heinz Küpper Provinzliteratur im mehrfachen Sinn geschrieben: angesiedelt in Provinzstädten wie Euskirchen, angesiedelt in der westdeutschen Provinz Eifel, angesiedelt im – gemessen an Metropolen wie London, Paris und New York – provinziellen Berlin. Was hätte er stattdessen tun sollen? Die Geschichten – ›seine‹ Geschichten – liegen doch überall in den hinterländischen Gossen herum. Küpper hat die Sprache dafür, also nichts wie ran an den Speck.
»Sind Heinz Küppers Bücher ›Provinzliteratur‹?« fragt Kraus lauernd, und ich antworte geschwind und nehme ihm (für den Moment jedenfalls …) den Wind aus den Segeln: »O ja, sehr gute sogar!« Dubliners von James Joyce, Deutschstunde von Siegfried Lenz, Die Blechtrommel von Günter Grass fallen mir, pars pro toto, als herausragende Beispiele ein, wenn ich den Begriff ›Provinzliteratur‹ denke. Viele große Romane der Weltliteratur sind Provinzliteratur. (›Provinzliteratur‹ ist seit etlichen Jahren im Literaturbetrieb ›in‹. Das hat mit dazu geführt, daß Norbert Scheuers schöne Literatur aus der Eifel im Feuilleton gerühmt und regelmäßig mit gut dotieren Preisen bedacht wird. Auf diese Weise ist Kall/Eifel zum literarischen Markenbegriff geworden. Jeden Leser, der diesen Prosaband noch nicht gelesen hat, möchte ich ermuntern, das demnächst einmal zu tun. Ein gut strukturiertes, schroffes Stück Literatur, dessen literarische Qualität im 2009 erschienenen Roman Überm Rauschen noch einmal bestätigt wird. Den Gedichtband Ein Echo von allem, dem ich in Ohne Punkt & Komma. Lyrik in den 90er Jahren, viele Seiten gewidmet habe, empfehle ich im selben Atemzug.) Der in Berlin ansässige Autor und Übersetzer Stefan Monhardt schreibt als Reaktion auf die Lektüre von Aus dem Hinterland. Lyrik nach 2000: »Provinz und Hinterland sind überall. Auch und gerade in Berlin.« So hat Heinz Küpper Provinzliteratur im mehrfachen Sinn geschrieben: angesiedelt in Provinzstädten wie Euskirchen, angesiedelt in der westdeutschen Provinz Eifel, angesiedelt im – gemessen an Metropolen wie London, Paris und New York – provinziellen Berlin. Was hätte er stattdessen tun sollen? Die Geschichten – ›seine‹ Geschichten – liegen doch überall in den hinterländischen Gossen herum. Küpper hat die Sprache dafür, also nichts wie ran an den Speck.
Zufall
Heinz Küpper muß nicht suchen, die Schreibanlässe fallen ihm, zwangsläufig, zu. So können die Themen der Romane und Erzählungen nicht gesucht wirken, wie das in den zeitgenössischen literarischen Erzeugnissen seit einiger Zeit vielleicht häufiger denn je der Fall ist. Das klingt im inneren Monolog der Grünschnäbel & Co. ungefähr so: »Worüber schreibe ich denn jetzt mal, ist ja schon alles abgegrast, ach ja, aber über die alten Griechen könnte ich doch etwas schreiben, was so noch niemand …«
Heinrich Böll, Peter Handke, W. G. Sebald – ich benenne exemplarisch drei Autoren mit höchst unterschiedlichen Schreibansätzen der Jahrgänge 1917, 1942 und 1944 – sind Autoren, die per se etwas zu sagen haben und das in der ihnen eigenen Art immer wieder meisterhaft vorführen. Auf diese Weise haben sie als leidvoll erlebte individuelle, gesellschaftliche, historische, politische Krisen ein Leben lang bearbeitet, um vielleicht am Ende einen Teilfrieden wenigstens zu machen mit sich und der Welt.
Hat Küpper diesen Frieden mit sich und seiner Welt machen können?
Der wie Heinz Küpper im Jahre 1930 geborene Helmut Kohl sprach früher schon mal gern von der »Gnade der späten Geburt«. Wat soll dat denn sein? Wir werden geboren, ohne daß uns jemand danach fragt. Dieser Tatbestand allein ist bereits gnadenlos. Egal: Für den Schriftsteller ist es vielleicht, je brisanter die Lage, eine Gnade, zum früheren Zeitpunkt geboren zu sein – so hart das für das zerbrechliche Ego sein und bis zum bitteren Ende wohl bleiben mag. Die außerordentlichen, bösen, harten Erfahrungen fehlen den jungen Schriftstellern, denen der erhitzte Babyspeck immer wieder zwischen die Zeilen tropft, im deutschen Sprachraum nach 2000. Von solchen extremen Erfahrungen, die man niemandem wünscht, führen selbst der ›erst‹ 1930 geborene Heinz Küpper und andere sensible Zeitgenossen soviel im Sturmgepäck mit sich, daß ich als Autor neidisch werden könnte. Der 1936 verstorbene Karl Kraus fällt nicht unter die historisch wohl einmalige Kohlsche Kategorie. Während ich diese Zeilen schreibe, fällt der Blick immer wieder auf die von Shafiq Naz besorgte Sammlung deutscher Dichtkunst Der deutsche Lyrikkalender. Jeder Tag ein Gedicht, und ich lese:
Man frage nicht, was all die Zeit ich machte. Ich bleibe stumm; und sage nicht, warum. Und Stille gibt es, da die Erde krachte. Kein Wort, das traf; man spricht nur aus dem Schlaf. Und träumt von einer Sonne, welche lachte. Es geht vorbei; Nachher war’s einerlei. Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte.Aber – was nützen alle Erfahrungen, wenn du die Sprache nicht hast? Böll hat sie, Sebald hat sie, Handke hat sie, Küpper hat sie, die unverwechselbare eigene Sprache. Ich lese drei Sätze und versinke in dieser Sprache. Egal, wie rauh der Ton, wie ernst das Thema, wie bedrückend das beschriebene Schicksal: Wie im Whirlpool komme ich mir vor, wie in eine flauschige Decke gehüllt, unter der es allerdings eisigfeurig heißfrostkalt werden kann. Je höher der alltägliche Druck, je mächtiger der Grad an Befremdung, je schärfer der Gegenwind, um so mehr Rückhalt, Trost, Verständnis, Zuflucht finde ich in den Büchern von Autoren, die mir ihre Sprache gleichsam zur Verfügung stellen, somit fortlaufend auch die rückversichernde Aleatorik des Reflektierens und das Spiel mit dem Eigenen möglich macht, wie Gerhard Falkner sich im Zusammenhang mit den besonderen Trümpfen des Lesens ausdrückt. Beim Lesen von Küppers Prosa höre ich die wie Lava aus dem Innersten flutende Stimme heraus. Er hat es einfach drauf, das epische Sprechen.
By the way:
Küppers Erzähler labern und schwafeln immer wieder mal gern. Nichts, was unkommentiert bliebe. Dazu fällt mir diese Stelle aus Kiesel & Kastanie ein: Schwafeln beispielsweise ist eine Todsünde guten Erzählens – außer, man beherrscht es so, wie Martin Walser es in den besten Romanen zeigt, ganz zu schweigen von Thomas Bernhard, der es von Roman zu Roman in höchste Höhen geführt hat. Ohne Heinz Küpper mit einem dieser beiden Autoren vergleichen zu wollen: Auch Heinz Küpper gehört in die Kaste der Meisterschwafler. Auf den 700 Seiten der Seelenämter übertreibt er es zuweilen, nein, immer wieder, wenn er seitenweise die Dinge buchstäblich bis zum Gehtnichtmehr dreht und wendet, wendet und dreht, um sie abschließende ein weiteres Mal zu drehen und zu wenden. Aber es muß wohl so sein.
 Beispielsweise im Vergleich mit einem Roman des bekannteren Raoul Schrott schneidet Seelenämter dennoch deutlich besser ab, wie ich in einem früheren Text über Küpper betone: »Bei Raoul Schrotts Mammutroman Tristan da Cunha oder Die Hälfte der Erde brauchte es 96 Seiten, um zu der Entscheidung zu kommen, auf die folgenden über 600 Seiten zu verzichten, was vielleicht ein Fehler war, wer weiß. Es gab zu dem Zeitpunkt zwar keinen eigentlichen Grund, die Lektüre abzubrechen, aber es sprach bis dahin auch nichts mehr dafür – diese tour de force sprach mich einfach nicht an. Oder lag es am nebligtrüben Wetter? An übersäuertem Magen? Während mich Schrotts Wälzer Die Erfindung der Poesie regelrecht zu Begeisterungsstürmen hingerissen hatte, konnte ich im Falle von Tristan nie die Aufregung nachvollziehen, die dieses Buch im Jahre 2003 unter den Kritikern hervorrief. Genausowenig verstehe ich, daß ein sich auf so originelle und eindringliche Art mit deutscher Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts befassender Autor wie Heinz Küpper nach 2000 fast keine Beachtung mehr findet in den Feuilletons in deutschen Landen. Heinz Küpper (1930–2005) hat beispielsweise mit Seelenämter, in dem der gewitzte Uraltpriester Jakob wieder einmal die erste Geige spielt, ebenfalls einen umfangreichen – geistreich, ironisch, lakonisch grundierten – Roman geschrieben, der lohnende Lektüre vom Anfang bis zum Ende garantiert.«
Beispielsweise im Vergleich mit einem Roman des bekannteren Raoul Schrott schneidet Seelenämter dennoch deutlich besser ab, wie ich in einem früheren Text über Küpper betone: »Bei Raoul Schrotts Mammutroman Tristan da Cunha oder Die Hälfte der Erde brauchte es 96 Seiten, um zu der Entscheidung zu kommen, auf die folgenden über 600 Seiten zu verzichten, was vielleicht ein Fehler war, wer weiß. Es gab zu dem Zeitpunkt zwar keinen eigentlichen Grund, die Lektüre abzubrechen, aber es sprach bis dahin auch nichts mehr dafür – diese tour de force sprach mich einfach nicht an. Oder lag es am nebligtrüben Wetter? An übersäuertem Magen? Während mich Schrotts Wälzer Die Erfindung der Poesie regelrecht zu Begeisterungsstürmen hingerissen hatte, konnte ich im Falle von Tristan nie die Aufregung nachvollziehen, die dieses Buch im Jahre 2003 unter den Kritikern hervorrief. Genausowenig verstehe ich, daß ein sich auf so originelle und eindringliche Art mit deutscher Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts befassender Autor wie Heinz Küpper nach 2000 fast keine Beachtung mehr findet in den Feuilletons in deutschen Landen. Heinz Küpper (1930–2005) hat beispielsweise mit Seelenämter, in dem der gewitzte Uraltpriester Jakob wieder einmal die erste Geige spielt, ebenfalls einen umfangreichen – geistreich, ironisch, lakonisch grundierten – Roman geschrieben, der lohnende Lektüre vom Anfang bis zum Ende garantiert.«
Der Faktor Übertreibung gehört ›natürlich‹ und ›naturgemäß‹ (wie es bei Thomas Bernhard, dem Weltmeister der Hyperbel, heißen würde) zum Baukasten des Schriftstellers Heinz Küpper. Dabei muß er damit rechnen, daß der ungeduldige Leser viele Seiten überspringt, wenn Jakob von Hölzchen auf Stöckchen, von Ästlein auf Zweiglein kommt, ja, das strengt auch schon einmal an beim Lesen, und man braucht ziemliche Ausdauer und zähe Beharrlichkeit, um manches Riff zu umschiffen, manche Klippe zu erklimmen, aber das kennen wir spätestens seit James Joyce, Robert Musil und Hermann Broch, von Hans-Henny Jahnn, Arno Schmidt und Peter Weiß ganz zu schweigen. »Ohne Fleiß kein Preis«, pflegten die Lehrer zu sagen, wenn ich die Hausaufgaben einmal wieder nicht vorlegen konnte, was in erster Linie an den dicken Büchern lag, die ich statt der Erledigung der Hausaufgaben las, aber das konnten die meisten Lehrer sich schlecht bloß vorstellen, und so habe ich es ihnen erst gar nicht zu vermitteln versucht.
Sag mir nicht …
»Ein Autor, dem es nicht gleichgültig ist, ob Leser ihm folgen oder nicht, kann kein guter Schriftsteller sein, ohne Kompromißlosigkeit geht gar nichts«, wirft Peer Quer mal wieder ungefragt ein. Diejenigen, die beispielsweise versucht haben, Heinz Küpper lektorierend unter die Arme zu greifen, wissen, wovon ich spreche. Ich kenne keine Einzelheiten, kann es mir bei diesem Euskirchener Eifeler jedoch lebhaft vorstellen. In die Augen (die mich aus einer Photographie heraus in einer Mischung von Distanz, Güte und Skepsis nicht unfreundlich anblicken), die mich in jenem Moment des vorsichtigen Versuchs, einen kleinen Veränderungsvorschlag zu machen, wohl angeblitzt hätten, hätte ich nicht schauen mögen. Womit ich nicht sagen will, daß ein Autor sich nichts sagen lassen soll. Ich bin davon überzeugt, auch Heinz Küpper hat Hinweise beherzigt. Zugegeben hat er es womöglich eher selten. Wiederum im deutschen Lyrikkalender lese ich, wie kategorisch Christian Saalberg mit dieser Frage umgeht. Die Auftaktzeilen des Gedichts lauten: Sag mir nicht, wie Gedichte zu schreiben sind. / Es wäre vergeudete Zeit.
 In Kiesel & Kastanie
In Kiesel & Kastanie
heißt es im Kapitel über die Erzählungen von Katja Kutsch: Flüssiges, klares, unprätentiöses Erzählen – und keinesfalls das pure Ausgestalten von Denk- oder Sprechblasen – steuert, reizvolle Stoffe und originelle Ideen vorausgesetzt, naturgemäß auf gute Geschichten zu, von denen lesende Menschen nie genug ergattern können. Gut erzählen konnte Heinz Küpper gut. Die Geschichten fesseln. Was er erzählt und wie er es erzählt, das ist interessant, spannend, überzeugend. Die Erzählstimmen kommen aus dem innersten Dasein, das verknüpft ist mit einer Kindheit und Jugend in einer westlichen Provinz Deutschlands im Dritten Reich und das beseelt ist von seiner Lebensgeschichte, die ihn zu seinem durch und durch sowie von Beginn an stimmigen Stil geführt hat, den ich lesend erlebe als fabelhaft ineinanderfließendes Konglomerat, das Schwingungen ermöglicht zwischen Geist und Gefühl, Ehrlichkeit und Schlitzohrigkeit, Ernst und Humor, Güte und Strenge, Klarheit und Rätsel, Intellekt und Gespür, inhaltlich-sprachlicher Authentizität und professioneller Formbewußtheit, Lockerheit und Disziplin »usw.«, wie es bei Friederike Mayröcker immer wieder heißt.
Feldwege · Boulevards
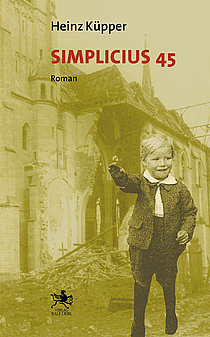 Wenn Küpper einmal die Fährte der Geschichte gewittert, gar Blut geleckt hat, läßt der innere Schriftstellerhund nicht mehr locker. Dann geht es, holterdiepolter, über Stock und Stein durch die miefigen Straßen von Euskirchen, über die holprigen Feldwege der Eifeler Höhendörfer und in die engen Gassen am Kölner Eigelstein. Nicht zu vergessen die beschädigten Berliner Boulevards, auf denen der Student aus dem Rheinland in die Fußstapfen von Bertolt Brecht und Gottfried Benn zu treten versucht. Da gibt es kein Halten mehr, und ich lese gebannt, den Rest der Umwelt vergessend, bis in die tiefe Nacht und die grauen Morgenstunden hinein, wie Ferver, Jakob und Konsorten hartnäckig deren Spuren nachgehen.
Wenn Küpper einmal die Fährte der Geschichte gewittert, gar Blut geleckt hat, läßt der innere Schriftstellerhund nicht mehr locker. Dann geht es, holterdiepolter, über Stock und Stein durch die miefigen Straßen von Euskirchen, über die holprigen Feldwege der Eifeler Höhendörfer und in die engen Gassen am Kölner Eigelstein. Nicht zu vergessen die beschädigten Berliner Boulevards, auf denen der Student aus dem Rheinland in die Fußstapfen von Bertolt Brecht und Gottfried Benn zu treten versucht. Da gibt es kein Halten mehr, und ich lese gebannt, den Rest der Umwelt vergessend, bis in die tiefe Nacht und die grauen Morgenstunden hinein, wie Ferver, Jakob und Konsorten hartnäckig deren Spuren nachgehen.
Sagt das alles etwas aus über die Qualität der Literatur Heinz Küppers und das Können dieses Schriftstellers? Das müssen Sie entscheiden. Ich mache mir in diesem Augenblick wieder einmal bewußt, daß Menschen eine Menge von sich selber ausplaudern, wenn sie vermeinen, über andere zu schreiben. Das macht nicht nur nichts, nein, das erscheint mir gut und richtig so und ist zudem unvermeidlich.
Notabene ›Qualität‹:
ein weiterer schwieriger, schwammiger, streitfördernder Begriff, wenn es um Literatur geht. (Immerhin – auf englisch oder niederländisch ein ausgesprochen schönes Wort.) Was ich als Möglichkeit der ›Qualitätsfindung‹ in der Literatur ausschließe: das Anlegen von Meßinstrumenten. Von Buch zu Buch glaube ich immer stärker – wie Smilla im Hinblick auf Schnee – das Gespür für die Qualität von Aufbau, Form, Sprache und Struktur in Gedichten, Erzählungen und Romanen zu empfinden. Dabei für mich entscheidend: Wort und Wortkombination (Kollokation bzw. Kookkurenz) – auch das Wort, das nicht verwendet wird. Das Territorium der Wörter: ein Minenfeld. Nicht nur Gedichte sind aus Wörtern gemacht. – – – Indem ich, solche Gedanken reflexiv einbeziehend, lese, möchte ich vermeiden, allzuviel Zeit mit Ausschuß und Schund zu vertun – nichts weiter. Kein ›Kritiker‹ hilft hier weiter: Der Leser, der naturgemäß mit jedem Buch an Erfahrung im Umgang mit Literatur gewinnt, ist sich selbst der Nächste. Auch Fräulein Smilla blieb mit ihrem Gespür für Schnee – allein.
›Eigentlich‹
Mit den 6.613 Wörtern dieses Essays will ich ›eigentlich‹ dies bloß zum Ausdruck bringen: Lesen Sie Heinz Küppers Bücher, machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Das hätte aber wahrscheinlich nicht gereicht, um als eigenständiger Beitrag hier veröffentlicht zu werden: So bin ich, wie die Oberstufenschüler bei der Gedichtanalyse, zur Geschwätzigkeit verdammt. Erfolgsgarantien im Hinblick auf Aussagekraft können im vorliegenden Fall allerdings grundsätzlich nicht gegeben werden. Einschätzungen erfolgen ohne Gewähr der Nachvollziehbarkeit. Ne jute Mann, hätte Adenauer vielleicht berlinert. Oder kannte er den 1930 geborenen Autor etwa, der 1963 mit Simplicius 45 debütierte?
 Lassen wir einmal dahingestellt sein, ob jener nicht immer so gute Mensch von Rhöndorf Simplicius 45 las oder nicht (die Zeit hätte er gehabt, nachdem er im selben Jahr den Kapellmeisterstab hatte übergeben müssen) – das Debüt Heinz Küppers war jedenfalls so vielversprechend, daß man eine Karriere à la Walter Kempowski erwarten durfte. (In dem 1972 bei Kröner publizierten Band Moderne Weltliteratur. Die Gegenwartsliteratur Europas und Amerikas betont Manfred Durzak die herausragende Stellung von Günter Grass’ Roman Die Blechtrommel innerhalb der deutschsprachigen Literatur nach 1945, in dessen Kontext Romane wie Manfred Bielers Bonifaz oder Der Matrose in der Flasche, Günter Kunerts Im Namen der Hüte, Paul Schallücks Don Quichotte in Köln, Gerhard Zwerenz’ Casanova und Heinz Küppers Simplicius 45 benannt werden.) Hier und dort war gelegentlich zu hören, Heinz Küpper sei in späteren Jahren nicht immer zufrieden gewesen mit dem Status, den er als Autor eines sehr kleinen Verlags in Deutschland einnahm. Walter Kempowski war das – bei wesentlich höheren Auflagen und einer zumindest moderaten feuilletonistischen Präsenz – auch nicht. Eine solche Präsenz ist ja nun für den eigentlichen Erfolg unwesentlich. Ich gehe dem Feuilleton gern aus dem Weg und nehme wirtschaftliche Verluste dabei, nur selten mit den Zähnen knirschend, in Kauf. Denn der Erfolg ist, ganz einfach, das gute Buch, das überzeugende Werk, das der Schriftsteller hinterläßt. ›Erfolg‹ ist aber auch, wenn die literarische Arbeit im Leben des Autors Funktionen übernehmen kann, Krisenmomente zu überstehen oder gar zu überwinden. Wenn ich Küppers autobiographische Schriften richtig verstehe, so war das Schreibzimmer für ihn immer wieder Refugium, Schlupfwinkel, Ausweg. Auch wenn Schreiben Knochenarbeit ist: Schreiben gehört zu den schönsten Tätigkeiten im Leben des Schriftstellers. Die förderlichen Faktoren für den ins Leben Geworfenen, dessen großes Glück das Schreiben ist, kann ich nicht hoch genug bewerten.
Lassen wir einmal dahingestellt sein, ob jener nicht immer so gute Mensch von Rhöndorf Simplicius 45 las oder nicht (die Zeit hätte er gehabt, nachdem er im selben Jahr den Kapellmeisterstab hatte übergeben müssen) – das Debüt Heinz Küppers war jedenfalls so vielversprechend, daß man eine Karriere à la Walter Kempowski erwarten durfte. (In dem 1972 bei Kröner publizierten Band Moderne Weltliteratur. Die Gegenwartsliteratur Europas und Amerikas betont Manfred Durzak die herausragende Stellung von Günter Grass’ Roman Die Blechtrommel innerhalb der deutschsprachigen Literatur nach 1945, in dessen Kontext Romane wie Manfred Bielers Bonifaz oder Der Matrose in der Flasche, Günter Kunerts Im Namen der Hüte, Paul Schallücks Don Quichotte in Köln, Gerhard Zwerenz’ Casanova und Heinz Küppers Simplicius 45 benannt werden.) Hier und dort war gelegentlich zu hören, Heinz Küpper sei in späteren Jahren nicht immer zufrieden gewesen mit dem Status, den er als Autor eines sehr kleinen Verlags in Deutschland einnahm. Walter Kempowski war das – bei wesentlich höheren Auflagen und einer zumindest moderaten feuilletonistischen Präsenz – auch nicht. Eine solche Präsenz ist ja nun für den eigentlichen Erfolg unwesentlich. Ich gehe dem Feuilleton gern aus dem Weg und nehme wirtschaftliche Verluste dabei, nur selten mit den Zähnen knirschend, in Kauf. Denn der Erfolg ist, ganz einfach, das gute Buch, das überzeugende Werk, das der Schriftsteller hinterläßt. ›Erfolg‹ ist aber auch, wenn die literarische Arbeit im Leben des Autors Funktionen übernehmen kann, Krisenmomente zu überstehen oder gar zu überwinden. Wenn ich Küppers autobiographische Schriften richtig verstehe, so war das Schreibzimmer für ihn immer wieder Refugium, Schlupfwinkel, Ausweg. Auch wenn Schreiben Knochenarbeit ist: Schreiben gehört zu den schönsten Tätigkeiten im Leben des Schriftstellers. Die förderlichen Faktoren für den ins Leben Geworfenen, dessen großes Glück das Schreiben ist, kann ich nicht hoch genug bewerten.
 Das Werk Heinz Küppers liegt seit etlichen Jahren – in Einzeltiteln sowie bei den Jakob-Romanen als Jubiläumsausgabe in drei Bänden – im Verlag Ralf Liebe (vormals Landpresse) vor. Es stellt in der Gesamtheit eine wesentliche Bereichung für jede Büchersammlung dar. Küpper ist eine markante Stimme der deutschen Nachkriegsliteratur, die nicht überhört werden darf. (Karl Otto Conrady) Heinrich Vormweg betont die Spannung, die sich auflädt aus der skrupellosen Sachlichkeit und unerbittlichen Intensität, mit denen dieser Erzähler Wahrnehmungen und Erfahrungen in die Sprache holt … Humor ist dabei nicht ausgeschlossen.
Das Werk Heinz Küppers liegt seit etlichen Jahren – in Einzeltiteln sowie bei den Jakob-Romanen als Jubiläumsausgabe in drei Bänden – im Verlag Ralf Liebe (vormals Landpresse) vor. Es stellt in der Gesamtheit eine wesentliche Bereichung für jede Büchersammlung dar. Küpper ist eine markante Stimme der deutschen Nachkriegsliteratur, die nicht überhört werden darf. (Karl Otto Conrady) Heinrich Vormweg betont die Spannung, die sich auflädt aus der skrupellosen Sachlichkeit und unerbittlichen Intensität, mit denen dieser Erzähler Wahrnehmungen und Erfahrungen in die Sprache holt … Humor ist dabei nicht ausgeschlossen.
 Apropos ›Werk‹:
Apropos ›Werk‹:
Fulminant ist die Umkreisung genannte Gesamtausgabe der Werke in einem – umfangreichen – Band von Rainer Maria Gerhardt (1927–1954), den ich vor wenigen Tagen gelesen habe. Gerhardt, im deutschen Sprachraum nahezu, bei Lyrikern und Lesern in den USA keineswegs vergessen, war der erste deutsche Übersetzer Ezra Pounds. Mit Hans Arp, Robert Creeley, Max Ernst, Charles Olson und anderen Künstlern und Dichtern jener Zeit befreundet, versucht er in den Jahren 1949 bis 1954 vehement, jedoch völlig vergeblich, die Moderne in dieses zerschossene Niemandsland zu katapultieren. Gerhardts totales Engagement kommt zu früh für ein Land, das zuerst einmal ein Wirtschaftswunder – mit allen Begleiterscheinungen – braucht, bevor es sich mit der in vielen Ländern seit Jahrzehnten etablierten Dichtung der Moderne auseinandersetzen kann. Als er den erlittenen Schiffbruch, entsetzt und verzweifelt, erkennt, nimmt Gerhardt sich das Leben. Das von Uwe Pörksen vorzüglich, ja, liebevoll edierte Gesamtwerk ist 2007 bei Wallstein in Göttingen erschienen. Es läßt mich die Augen untertassengroß aufreißen angesichts eines in nur wenigen Jahren entstandenen lyrischen, essayistischen, herausgeberischen, korrespondierenden, übersetzerischen und verlegerischen Gewaltakts. Hätte Gottfried Benn sich für diesen Fall einmal bloß vom Olymp herabbegeben und Gerhardt und dessen fragmente-Initiativen mit kleinen Hinweisen gefördert, statt sich ihrer zu bedienen und fortan gegen den offenbar als Bedrohung empfundenen genialischen, unerschrockenen, zornigen jungen Mann zu intrigieren, die Lyrik der 1950er Jahre, zu deren Verächtern ich notabene nicht gehöre, hätte wohl eine andere Entwicklung genommen. Hans Magnus Enzensberger und Rolf Dieter Brinkmann taten auf ihre Art das, was Gerhardt verwehrt blieb. Das 1960 von Enzensberger eingerichtete Museum der Poesie und Brinkmanns Acid. Neue amerikanische Szene von 1969 sind internationale Lyrik nach Deutschland befördernde Anthologie-Klassiker, bei denen Rainer Maria Gerhardt als Lyrikerzengel mit himmlischem Fingerzeig Pate gestanden hat – garantiert.
Gemessen also an Rainer Maria Gerhardt steht Heinz Küpper mit Werk und Wirkung im deutschen Sprachraum so schlecht nicht da. Ein weiterer Autor, der mir in diesem Zusammenhang einfällt, ist Christian Saalberg (1926–2006), über den ich an anderer Stelle schreibe:
Seit jeher
ist es das gleiche Spiel zwischen öffentlichem Erfolg und Literaturbetrieb: Die einen, die (nicht immer gar so) gut sind, werden irgendwie nach oben gespült, sind in aller Munde und behaupten sich oft über Jahrzehnte, die anderen, die bisweilen besser sind, bleiben unter Insidern hochgehandelte Geheimtips, von denen die Mehrzahl der Feuilletonisten nicht einmal ahnt, daß es sie gibt. Der begnadete Dichter Christian Saalberg, der 1963 mit Die schöne Gärtnerin debütierte und der an Christi Himmelfahrt 2006 im Alter von achtzig Jahren verstarb, war Zeit seines Lebens ein solcher Geheimtip. Hätte er ein wenig mehr Aufhebens um die eigene Person gemacht, hätte er die richtigen Kontakte gehabt, hätte er einmal durch einen guten Zufall den richtigen Menschen bei den entsprechenden Empfängen, zu denen er nicht ging, getroffen, so wäre ihm weit mehr Beachtung geschenkt worden, als dies der Fall war.
Mit Heinz Küpper ist es ähnlich. Symptomatisch der freundschaftliche Kontakt zu Heinrich Böll, von dem er selber nicht wweiß, warum er diesen nach einigen Jahren einschlafen läßt, wie ich in einem Text des Erzählbandes Hermann Rohr und andere lese. Nach Jahren trifft man sich noch einmal zufällig bei einer Veranstaltung, und Böll fragt, warum Küpper sich nicht mehr gemeldet habe. Dabei bleibt es. Mit ziemlicher Sicherheit hätte Böll sich von Küpper nicht zweimal bitten lassen müssen, Verbindungen herzustellen. Das aber war nie Küppers Ding. Er ging konsequent und im besten Sinne halsstarrig seinen Weg.
 »Es ist halt alles relativ«,
»Es ist halt alles relativ«,
heißt es in Ödön von Horváths Theaterstück Italienische Nacht. Wir wissen, daß Horváth am 1. Juni 1938 im Pariser Café Marignan den Regisseur Robert Siodmak trifft, um mit ihm über die Verfilmung des Romans Jugend ohne Gott zu sprechen, und daß er am selben Abend während eines Gewitters auf den Champs-Élysées durch einen herabstürzenden Ast erschlagen wird. Horváth wird 37 Jahre alt. Wer liest noch die Romane – Der ewige Spießer, Jugend ohne Gott, ein Kind unserer Zeit – dieses großartigen Autors? Es ist halt alles relativ.
Hat Heinz Küpper über diese banale Erkenntnis im Zusammenhang mit Werk und Rezeption in Deutschland nachgedacht? Beneidete er Heinrich Böll um dessen großen Erfolg? War er später (nachdem er völlig in Vergessenheit zu geraten drohte) zufrieden mit der Tatsache, daß ein ehemaliger Schüler ihm die Gelegenheit bot, daß die Romane wiederaufgelegt und die neuen in dessen Verlag erscheinen konnten? Oder hoffte er, daß diese Gelegenheit bloß Sprungbrett sein möge, um in höhere Verlagssphären zu gelangen? Unter den Autoren, die in der Eifel geboren wurden bzw. hier gelebt haben, zähle ich Küpper zu den wenigen, deren literarische Werke Kieselsteine, wenn nicht Felsbrocken sind in der zerklüfteten LiteratUrlandschaft des deutschen Sprachraums.
Im Wikipedia-Artikel lese ich:

Der Westwall in der Eifel
Die Eifel liegt zwischen Aachen im Norden, Trier im Süden und Koblenz im Osten. Sie fällt im Nord-Osten entlang der Linie Aachen – Düren – Bonn zur Niederrheinischen Bucht ab. Im Osten und Süden wird sie vom Rhein- und Moseltal begrenzt. Westwärts geht sie in Belgien und Luxemburg in die geologisch verwandten Ardennen und den Luxemburger Ösling über. Sie berührt Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie den Raum Eupen – Sankt Vith – Luxemburg. Die höchste Erhebung ist die Hohe Acht (747 m), ein Vulkankegel. Ihren Namen erhielt die Eifel vom karolingischen Eifelgau, der annähernd dem Gebiet um die Quellen der Flüsse Ahr, Kyll, Urft und Erft entsprach. Autoren aus an die Eifel angrenzenden Städten wie Aachen, Bonn, Koblenz und Düren sowie den Ländern Belgien und Luxemburg berücksichtige ich in der Zusammenstellung vom Sistiger Sehepunkt aus nicht. Grenzfälle bleiben – gerade in diesem Gebiet – immer.
 Den exzellenten Roman Eifel des in Trier lebenden Schweizers Walter Schenker, dessen Erstausgabe 1982 bei Ammann in Zürich erschien, möchte ich allerdings ebensowenig unerwähnt lassen wie die 2008 erschienene Erzählung Schullandschaft mit Lehrer des Luxemburgers Henri Dor, die wie ein Film vorm geistigen Auge abläuft. Endlich eine sich mit dem Spannungsfeld Schule, Lehrer, Schüler, Eltern, Gesellschaft in dieser Zeit auseinandersetzende Geschichte mit Biß und Tiefgang, die mich von der ersten Zeile an in den Bann zieht und bis zur letzten nicht losläßt.
Den exzellenten Roman Eifel des in Trier lebenden Schweizers Walter Schenker, dessen Erstausgabe 1982 bei Ammann in Zürich erschien, möchte ich allerdings ebensowenig unerwähnt lassen wie die 2008 erschienene Erzählung Schullandschaft mit Lehrer des Luxemburgers Henri Dor, die wie ein Film vorm geistigen Auge abläuft. Endlich eine sich mit dem Spannungsfeld Schule, Lehrer, Schüler, Eltern, Gesellschaft in dieser Zeit auseinandersetzende Geschichte mit Biß und Tiefgang, die mich von der ersten Zeile an in den Bann zieht und bis zur letzten nicht losläßt.
Diese kleine, aber schlagkräftige Literaturkohorte besteht aus einer guten Handvoll von Einzelkämpfern, die ich in alphabetischer Reihenfolge kurz vorstelle:
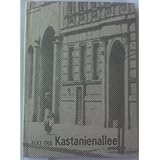 Der 1947 in Dinklage geborene und in Houverath bei Bad Münstereifel lebende Jochen Arlt hat sich als Autor mehrerer Gedichtbände, vielleicht mehr noch als Herausgeber zahlreicher wegweisender regionaler Anthologien einen guten Namen gemacht. Elke Erb, 1938 in Scherbach bei Rheinbach geboren und in Berlin lebend, gehört zu den originellsten Schöpferinnen von Literatur in Deutschland. Ursula Krechel wurde 1947 in Trier geboren, nach langen Jahren in Frankfurt am Main lebt sie heute in Berlin. Aus ihrem Werk mit zahlreichen originellen Lyrik- und Prosatiteln hebe ich hier den Roman Sizilianer des Gefühls hervor, der bedeutsame Bezüge zur Eifel aufweist. Rolf Persch, 1949 in Bonn geboren, lebt seit 1999 in Üxheim. Er hat rund zehn Gedichtbände veröffentlicht, von denen ich mein stuhl und ich sowie das kleid unseres duft, beide in der edition fundamental erschienen, gelesen habe. Norbert Scheuer, 1951 in Prüm geboren und in Kall-Keldenich lebend, tut sich als nüchterner Chronist der Heimat hervor. Er verfaßt Gedichte, kurze Prosa und Romane, in denen mit lakonischer, ungeschönter Sprache Eifeler Einzelschicksale porträtiert werden, die exemplarisch stehen für das nicht immer einfache Leben in einer abseitigen Region. Clara Viebig wurde 1860 in Trier geboren, sie starb 1952 in Berlin. Innerhalb ihres großen Werks spielen die in der Eifel angesiedelten Romane, von denen ich Das Weiberdorf stellvertretend benenne, eine zentrale Rolle. Zu guter Letzt gehört in diese Runde Theodor Weißenborn, 1933 in Düsseldorf geboren und in Hof Raskop bei Landscheid lebend, der zwar über fünfzig Bücher geschrieben hat, von denen ich Die Killer sowie Fragmente der Liebe. Prosa aus fünf Jahrzehnten gelesen habe.
Der 1947 in Dinklage geborene und in Houverath bei Bad Münstereifel lebende Jochen Arlt hat sich als Autor mehrerer Gedichtbände, vielleicht mehr noch als Herausgeber zahlreicher wegweisender regionaler Anthologien einen guten Namen gemacht. Elke Erb, 1938 in Scherbach bei Rheinbach geboren und in Berlin lebend, gehört zu den originellsten Schöpferinnen von Literatur in Deutschland. Ursula Krechel wurde 1947 in Trier geboren, nach langen Jahren in Frankfurt am Main lebt sie heute in Berlin. Aus ihrem Werk mit zahlreichen originellen Lyrik- und Prosatiteln hebe ich hier den Roman Sizilianer des Gefühls hervor, der bedeutsame Bezüge zur Eifel aufweist. Rolf Persch, 1949 in Bonn geboren, lebt seit 1999 in Üxheim. Er hat rund zehn Gedichtbände veröffentlicht, von denen ich mein stuhl und ich sowie das kleid unseres duft, beide in der edition fundamental erschienen, gelesen habe. Norbert Scheuer, 1951 in Prüm geboren und in Kall-Keldenich lebend, tut sich als nüchterner Chronist der Heimat hervor. Er verfaßt Gedichte, kurze Prosa und Romane, in denen mit lakonischer, ungeschönter Sprache Eifeler Einzelschicksale porträtiert werden, die exemplarisch stehen für das nicht immer einfache Leben in einer abseitigen Region. Clara Viebig wurde 1860 in Trier geboren, sie starb 1952 in Berlin. Innerhalb ihres großen Werks spielen die in der Eifel angesiedelten Romane, von denen ich Das Weiberdorf stellvertretend benenne, eine zentrale Rolle. Zu guter Letzt gehört in diese Runde Theodor Weißenborn, 1933 in Düsseldorf geboren und in Hof Raskop bei Landscheid lebend, der zwar über fünfzig Bücher geschrieben hat, von denen ich Die Killer sowie Fragmente der Liebe. Prosa aus fünf Jahrzehnten gelesen habe.
Endorphin
 Es hat sich herumgesprochen, daß ich zu den Menschen gehöre, bei denen das Geräusch eines vor dem Haus haltenden Personenkraftwagens mit gelber Farbe einen unvermittelten Endorphinschub auslöst. Wie recht hatte Pawlow mit dem hündischen Versuch. Jeden und jeden Tag verspüre ich ab zehn Uhr fünfzehn dieses prickelnde Gefühl im Bauch, und ab zehn Uhr fünfunddreißig stehe ich komplett unter Strom. Die Anspannung wird beinahe unerträglich, wenn der Postbote aussteigt und zunächst die drei Häuser gegenüber und neben uns bedient. Stets kommt er zu uns zuletzt. Oft muß er noch einmal zurück zum Auto, um kleinere oder größere Sendungen aus dem Kofferraum zu holen. An einem Morgen, im Lyrikkalender lese ich in einem Gedicht Erich Frieds An ihren Worten hast du sie erkannt, / mit ihren Worten hast du sie erschlagen, bringt er ein Paket von Zweitausendeins, das mit zehn zeitgenössischen Romanen bestückt ist: Matthias Altenburg ∙ Landschaft mit Wölfen (1997), Volker Braun ∙ Das Wirklichgewollte (2000), Michael Krüger ∙ Das falsche Haus (2002), Michael Lentz ∙ Muttersterben (2002), Friederike Mayröcker ∙ Magische Blätter (2001), Armin Müller-Stahl ∙ Hannah (2004), Adolf Muschg ∙ Das gefangene Lächeln (2002), Cees Nooteboom ∙ Die folgende Geschichte (1991), Thomas Rosenboom ∙ Neue Zeiten (2004) und Peter Weber ∙ Bahnhofsprosa (2002). Die Bücher lenken zunächst von den Gedanken an Heinz Küpper ab, um sogleich schnell zu ihm zurückzuführen. Ich setze doch so gern Autoren und Bücher zueinander in Beziehung: Wen oder was ordne ich nun neben, über, unter wem oder was ein, was ist Kiesel, was ist Brocken? Die Lektüre wird es zutage fördern.
Es hat sich herumgesprochen, daß ich zu den Menschen gehöre, bei denen das Geräusch eines vor dem Haus haltenden Personenkraftwagens mit gelber Farbe einen unvermittelten Endorphinschub auslöst. Wie recht hatte Pawlow mit dem hündischen Versuch. Jeden und jeden Tag verspüre ich ab zehn Uhr fünfzehn dieses prickelnde Gefühl im Bauch, und ab zehn Uhr fünfunddreißig stehe ich komplett unter Strom. Die Anspannung wird beinahe unerträglich, wenn der Postbote aussteigt und zunächst die drei Häuser gegenüber und neben uns bedient. Stets kommt er zu uns zuletzt. Oft muß er noch einmal zurück zum Auto, um kleinere oder größere Sendungen aus dem Kofferraum zu holen. An einem Morgen, im Lyrikkalender lese ich in einem Gedicht Erich Frieds An ihren Worten hast du sie erkannt, / mit ihren Worten hast du sie erschlagen, bringt er ein Paket von Zweitausendeins, das mit zehn zeitgenössischen Romanen bestückt ist: Matthias Altenburg ∙ Landschaft mit Wölfen (1997), Volker Braun ∙ Das Wirklichgewollte (2000), Michael Krüger ∙ Das falsche Haus (2002), Michael Lentz ∙ Muttersterben (2002), Friederike Mayröcker ∙ Magische Blätter (2001), Armin Müller-Stahl ∙ Hannah (2004), Adolf Muschg ∙ Das gefangene Lächeln (2002), Cees Nooteboom ∙ Die folgende Geschichte (1991), Thomas Rosenboom ∙ Neue Zeiten (2004) und Peter Weber ∙ Bahnhofsprosa (2002). Die Bücher lenken zunächst von den Gedanken an Heinz Küpper ab, um sogleich schnell zu ihm zurückzuführen. Ich setze doch so gern Autoren und Bücher zueinander in Beziehung: Wen oder was ordne ich nun neben, über, unter wem oder was ein, was ist Kiesel, was ist Brocken? Die Lektüre wird es zutage fördern.
 In diesem Augenblick
In diesem Augenblick
vergleiche ich zum erstenmal Heinz Küpper mit dem Schweizer Autor Werner Bucher (1938), dessen gesamte – formale, sprachliche und strukturelle – Art, Literatur zu verfassen, der Heinz Küppers nahekommt, ohne daß man einander einen Platz streitig machen könnte: Beide sind dafür viel zu starke, knorrige, den eigenen Weg beschreitende Schriftstellertypen mit jeweils reichhaltigem Fundus an Lebensgeschichte. Schriebe ich einen weiteren Absatz über Küpper, gliche dieser in verblüffender Weise dem, was ich vor einiger Zeit in Kiesel & Kastanie über Bucher schrieb:
»Werner Bucher hat in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von gewichtigen Zeit- bzw. Gesellschaftsromanen (unter dem Pseudonym Jon Durschei auch Kriminalromane geschrieben, deren Helden die kleinen Leute, die Außenseiter oder die Menschen sind, die nicht anders können, als Sand ins Getriebe der Welt zu streuen. Ich schätze Werner Bucher als beherzten und engagierten Autor von Romanen, die mir unter die Haut gehen. Unter den fünf Romanen – Tour de Suisse (1977), Ein anderes Leben (1981), Lazarus (1989), Unruhen (1998) und Im Schatten des Campanile (2000) haben mich Ein anderes Leben (die Aufarbeitung der traurigen Lebensgeschichte des Vaters) und Unruhen (die Auseinandersetzung mit den Studentenunruhen in Zürich) ganz besonders in den Bann gezogen. Die Helden Buchers sprechen eine eigene klare Sprache. Sie werden als eigensinnige, kritische Köpfe in Unruhen oder Im Schatten des Campanile bekämpft bzw. argwöhnisch beäugt, und ihnen liegt eins sehr am Herzen: die Welt ein bißchen wenigstens besser zu machen. Dieses Sendungsbewußtsein hält der Schriftsteller Bucher formal in Schach, indem er die Gedanken, Gefühle, Beschreibungen und Erzählungen wachsam und vorsichtig, klar und zupackend verfertigt; darüber hinaus finden die stets zündstoffgeladenen Geschichten Individuum kontra Gesellschaft gern auf verschiedenen geistigen und zeitlichen Ebenen statt. So wird ihnen eine komplexe Struktur zuteil, die entscheidend zur Zeitlosigkeit der engagierten Prosa Werner Buchers beiträgt.«
Westdeutsche Familiengeschichte
Während ich das vorletzte der zehn Bücher Heinz Küppers lese – den schmalen Erzählband Westdeutsche Familiengeschichte von 2004 – überprüfe ich nolens volens das, was ich in den letzen Wochen zu Heinz Küpper und dessen Prosa gedacht und in den vergangenen Tagen formuliert habe. Mit Bedacht läßt Küpper die hochgebildeten Erzähler die Worte wählen, ohne Eile, ausführlich erzählen sie die Geschichten (gern auch Geschichten in der Geschichte). Immer vermeine ich den rheinischen Tonfall bei den stets redegewandten, vordergründig eher bescheiden als großspurig auftretenden Erzählern herauszuhören, die nach und nach all das zum besten geben, was ihr unerschütterliches Anliegen ist. Eindringliches und lakonisches Erzählen, ironisches und selbstironisches Reflektieren, detailgenaue und sinnliche Darstellung, schlitzohrige und ernsthafte Vertiefung des Inhalts, Motivs, Themas oder Sachverhalts sind den Küpperschen Erzählern stets zu eigen.
Metaprachlich

Die Urft (mit Stausee) · Quelle: Wikipedia
»Keine Bange«, ermutige ich Mrs Columbo, die noch nicht restlos überzeugt zu sein scheint, »selbst die metasprachlichen Auslassungen sind amüsant.« Denn vom spezifischen Autorentemperament her kann Küpper gar nicht anders, als die von ihm erfundenen Erzähler zwar genau, sogar penibel, aber gleichzeitig humorvoll mit den Kümmernissen und bisweilen angedeuteten theoretischen Grundvoraussetzungen des Daseins umgehen zu lassen. Sie behaupten in luftigen Erzählhöhen gern, nicht Herr der Erzählung zu sein, behalten gleichzeitig unterm Tisch die Fäden fest in der Hand, lassen nicht locker, bis sie die Geschichte (die nicht gut ausgehen muß) erzählt haben. Sie bedienen sich innerhalb der weitschweifenden Satzgefüge der kompletten Registratur der Sprachorgel: In den wie Ahr, Rur, Erft, Kyll und Urft dahinfließenden Grundton tröpfeln – naturgemäß – die verschiedensten Wortklänge, die mal ›altväterlich‹, mal jungspundforsch (›gaga‹), mal salopp, zumeist jedoch von lakonischer Art sind, und sie greifen, grobschlächtig, wie sie zwischendurch gern einmal sind, ohne mit der Wimper zu zucken, so es denn ›zum Verrecken‹ notwendig ist, in eine der unteren Schubladen. Gern stellen sie – den Verlauf typischer deutscher Syntax unterwandernd – Adverbien, um der Betonung willen, ans Ende der Hauptsätze, damit diesen selbstredend weitere veranschaulichende, be- und umschreibende Nebensätze bzw. erweiterte Infinitive einschließlich aller erforderlichen Aufzählungen und Einschübe folgen können. Es ist nicht mehr und nicht weniger als das Unerläßliche und selten ein Wort zuviel. Im zweiten Roman, dem spröden Milch und Honig, dem einzigen Buch Küppers, bei dem ich als Leser nicht so recht auf Betriebstemperatur komme, schon gar nicht.
Die klugen (auch bauernschlauen) Erzähler wissen sehr genau, wovon sie sprechen: Der Background der jeweiligen Sachthemen ist lückenlos recherchiert und wird zwar en passant, aber unerbittlich eingeflochten in den Gang der Geschehnisse. Da kennt Küpper kein Pardon: Er gewährt den Erzählern betont lange Leine, räumt ihnen alle Zeit der Welt ein, sich zu erklären, Fachlexika zu zitieren, Sprachunterschiede zu erläutern, aber niemals denke ich, der Schwimmer in diesem Delta, ich sei in einer langweiligen Seminarveranstaltung, nein, stets bin ich auf der Hut, vernehme jedes einzelne Wort und bin gespannt, wohin die Geschichte denn jetzt schon wieder mit mir will. »Herrlich«, würde der Kölner Dachdeckermeister Benether dazu sagen, läse er Küppers Erzählungen, wozu er sich die Zeit aber wahrscheinlich nicht nehmen kann, zu sehr ist er damit befaßt, telefonisch die verrücktesten Aufträge loszuwerden. (Apropos Köln: Küpper setzt dem Gesamtkunstwerk der Trude Herr in Westdeutsche Familiengeschichte ein schönes Denkmal. Angeregt durch die Lektüre dieser einfühlsam verfaßten Zeilen, habe ich mir umgehend Gérard Schmidts 1991 erschienene 320seitige biographische Aufzeichnungen Trude Herr. Niemals geht man so ganz besorgt. Auch ich bin ein Verehrer dieser wunderbaren Frau. Ihr Song Die Unschuld ist große Kunst.)
Immer wieder
elektrisieren mich Passagen und Sequenzen, von denen ich die von den Steinen auf des Thomas Grab aus Westdeutsche Familiengeschichte hier festhalte; sie erscheinen mir im Kern wie Kennzeichnungen dessen, was Literatur, wie Heinz Küpper sie schreibt, kann:
Ich habe sie im Auge. Ich glaube nicht mehr, daß es sich um Kieselsteine handelt, die auf das Grab geschüttet worden sind. Kieselsteine, auch die weißesten, die reinrassig weißen, strahlen nicht eine solche Leichenfarbe aus, fühlen sich nicht körnig an, lassen sich nicht ankratzen mit einem scharfen Strahl, bis sie bröckeln und Krümel absondern. Kieselsteine sind fest und zeigen doch Strukturen, Linien, die Segmente abgrenzen, zeigen Farbnuancen, Farbspiele. Auch in den weißen schimmert ein Hauch von Farbe auf, und wie sie sich anfühlen! Unnachgiebig und doch freundlich für den Tastsinn in unserer Epidermis! Jeder Kieselstein ist ein Kerl wie Samt und Seide, wie es in dem Liedchen ein Mann von sich selber besingt:
War das ne große Freud, als mich der Herrgott schuf. Ein Kerl wie Samt und Seide, nur schade, daß er suff.
Die Versiegelung
Literarische Präsenz und Wirkung Heinz Küppers, dieses authentischen, engagierten, leidenschaftlichen, streitbaren, treuen, zuverlässigen Menschen mit kerniger und einer dem unaufhörlich mäandernden Denken angepaßten Sprache, sind noch längst nicht ausgereizt in diesen unwegsamen, nicht zu überschauenden deutschen Literaturlanden, nicht einmal für Leser, die das Werk bereits vollständig zu kennen glauben. (In ›meinem‹ Fall harrt der Roman Linker Nebenfluß der Donat der Lektüre: Wahrscheinlich würde ich ihn gar nicht wiedererkennen. Andererseits macht er mich bestimmt nicht auf seine Person aufmerksam, wenn er mich einmal sieht in der Stadt. Ich habe ihn höchstens sechs-, siebenmal in meinem Wagen mitgenommen. Meistens saß er hinten, eingequetscht zwischen die anderen, auf einem Platz, den es amtlich überhaupt nicht gab. Einmal, als wir zwei alleine fuhren, hat er vorn neben mir gesessen, einmal bei Überfüllung lag er im Kofferraum, den ich etwas offenließ.) Sollte dies also noch eines Beweises bedürfen, hier die letzten, selbstredend dem Schriftsteller Heinz Küpper eingeräumten Worte dieses Essays, gelesen in der Erzählung Die Versiegelung, die auf ihren gut fünfzig Seiten all das aufblitzen läßt, was Heinz Küppers Prosa auszeichnet und wesentlich macht:
Als nun der Lügenbold Hitler, der ihm eine Zeitlang über zu sein schien, in mir langsam, aber sicher abstarb wie ein Abszeß in der Lunge und ich wieder atmen konnte, zum ersten Mal frei atmen konnte, tat ich das gleich exzessiv und wurde für ein Jahr Atheist und pfiff auf alles. Ich hatte noch keinen Bart, und eine Sonderkarte für Rasierseife stand mir mit meinen 15 Jahren auch noch nicht zu. Mein Freund Matthias, der nicht älter war als ich, hatte einen und ließ ihn stehen und ging so aufs Kartenamt und bekam eine. Zum Appell brauchte niemand mehr (was für eine absurde Vorstellung: ich muß zum HJ-Dienst). Aber in die Kirche gingen wir wieder alle, ob Stoppelträger oder Milchgesicht, wir, die man ein Jahrzehnt später die weißen Jahrgänge nennen würde, weil wir zwar im Krieg, aber so gerade nicht mehr Soldat gewesen waren. Zur Bundeswehr ging dann nur einer von uns, in die Kirche alle außer den evangelischen und dem einen katholischen Jungen, den die Amerikaner als Werwolf mit Schußwaffe erwischt, vor ein Gericht gestellt und im Sommer 45 in einer Sandkuhle erschossen hatten.
* * *
Der Zaungast ∙ Roman ∙ 416 Seiten ∙ Landpresse ∙ Weilerswist 2002. Die Versiegelung ∙ Erzählung ∙ 52 Seiten ∙ In: Simplicius und die Seinen ∙ Geschichtsverein ∙ Euskirchen 2009. Hermann Rohr und andere. Erzählungen vom Rand der Biographie∙ 199 Seiten ∙ Landpresse ∙ Weilerswist 1998. Linker Nebenfluß der Nogat ∙ Roman ∙ 336 Seiten ∙ Verlag Ralf Liebe ∙ Weilerswist 2009. Milch und Honig ∙ Roman ∙ 143 Seiten ∙ Middelhauve ∙ Köln 1965. Seelenämter ∙ Roman ∙ 567 Seiten ∙ Landpresse ∙ Weilerswist 2000. Simplicius 45 ∙ Roman ∙ 188 Seiten ∙ Landpresse ∙ Weilerswist 1997. Westdeutsche Familiengeschichte. Drei Erzählungen∙ 62 Seiten ∙ Landpresse ∙ Weilerswist 2004. Wohin mit dem Kopf ∙ Kriminalerzählung ∙ 135 Seiten ∙ Landpresse ∙ Weilerswist 1998. Zweikampf mit Rotwild ∙ Roman ∙ 334 Seiten ∙ Landpresse ∙ Weilerswist 1996. Weiterfühend → Ulrich Bergmann mit einen Kommentar zu frühen Gedichten Heinz Küpper. In memoriam Heinz Küpper (* 10. November 1930 in Euskirchen; † 18. November 2005 in Mechernich)* * *
Weiterführend→ Ein Essay über den Lyrikvermittler Theo Breuer.

Poesie zählt für KUNO zu den identitäts- und identifikationstiftenden Elementen der Kultur
→ Poesie zählt für KUNO zu den identitäts- und identifikationstiftenden Elementen einer Kultur, dies bezeugt der Versuch einer poetologischen Positionsbestimmung. Um den Widerstand gegen die gepolsterte Gegenwartslyrik ein wenig anzufachen schickte Wolfgang Schlott dieses post-dadaistische Manifest. Warum Lyrik wieder in die Zeitungen gehört begründete Walther Stonet, diese Forderung hat nichts an Aktualität verloren. Lesen Sie auch Maximilian Zanders Essay über Lyrik und ein Rückblick auf den Lyrik-Katalog Bundesrepublik. KUNO schätzt den minutiösen Selbstinszenierungsprozess des lyrischen Dichter-Ichs von Ulrich Bergmann in der Reihe Keine Bojen auf hoher See, nur Sterne … und Schwerkraft. Gedanken über das lyrische Schreiben. Lesen Sie ein Porträt über die interdisziplinäre Tätigkeit von Angelika Janz, sowie einen Essay der Fragmenttexterin. Ein Porträt von Sophie Reyer findet sich hier, ein Essay fasst das transmediale Projekt „Wortspielhalle“ zusammen. Auf KUNO lesen Sie u.a. Rezensionsessays von Holger Benkel über André Schinkel, Ralph Pordzik, Friederike Mayröcker, Werner Weimar-Mazur, Peter Engstler, Birgitt Lieberwirth, Linda Vilhjálmsdóttir, und A.J. Weigoni. Lesenswert auch die Gratulation von Axel Kutsch durch Markus Peters zum 75. Geburtstag. Nicht zu vergessen eine Empfehlung der kristallklaren Lyrik von Ines Hagemeyer. Diese Betrachtungen versammeln sich in der Tradition von V.O. Stomps, dem Klassiker des Andersseins, dem Bottroper Literaturrocker „Biby“ Wintjes und Hadayatullah Hübsch, dem Urvater des Social-Beat, im KUNO-Online-Archiv. Wir empfehlen für Neulinge als Einstieg in das weite Feld der nonkonformistischen Literatur diesem Hinweis zu folgen.