Sarah lernte ich an einem frühen Sonntagmorgen im Februar 2000 kennen, gleich in der ersten Stunde, nachdem ich aufgewacht war. Sie betrat den Raum, in dem ich an meinem Computer saß, kam auf mich zu und blieb vor meinem Schreibtisch stehen. Sie trug ein schwarzes, eng anliegendes Kleid mit rund geschnittenem Kragen und langen Ärmeln. Der Gedanke, sie muss es einen Abend zuvor angezogen und seitdem nicht mehr ausgezogen haben, durchstreifte den Raum zwischen uns.
Sie runzelte ein wenig, während sie mich beobachtete, als hätte sie eine kuriose Erscheinung vor den Augen, als entspräche dies, was sie sah, nicht unbedingt dem, was sie erwartet hatte.
Das irritierte Staunen in ihrem Blick, dachte ich gleich, musste unmittelbar mit dem Ausmaß dieser Erwartungen zusammengehangen haben. Was meine Erwartungen betraf, so hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keine.
– „Ich bin Sarah Sylvia Sander“, sagte sie.
Sarah Sylvia Sanders Gesichtsausdruck war nicht zu deuten.
Leicht verachtend, ironisch, distanziert. Dennoch zärtlich, nachsichtig. Erwartungsvoll. Kampflustig.Zu widersprüchlich waren die Eindrücke, als dass ich dem, was ich sah, auch vertrauen konnte. Der Zwiespalt des Wahrnehmens zwischen schlichtem Hinsehen und bewussten Ansehen reizte mich und löste augenblicklich in mir eine Kettenreaktion aus, eine Bildlawine. Schnell ineinander fließende Sichten, die schließlich zu einem einheitlichen Gebilde verschmolzen.
Ich zog die Tastatur näher und schrieb:
– „Mein zweiter Name ist auch Sylvia“, sagt Sarah Sylvia Sander, während sie in einem Erzählungsband von Sylvia Plath blättert. Sie findet, sie habe mit der Plath, trotz des gleichen Vornamens, nichts gemeinsam. Nichts.
Es sei denn zuweilen die Todessehnsucht.
– „Wie ich sehe, hast du bereits angefangen…“, sagte die Sarah vor meinem Schreibtisch.
– „…bin mit diesem Satz heute morgen aufgewacht, wollte ihn nicht vergessen …“, erwiderte ich.
Sarah beugte sich über den Tisch und las den Text auf dem Bildschirm.
– „Warum die Plath?“ fragte sie.
– „Es ist ein Anfang…“
– „Meinetwegen… Es ist mir egal, wie du das anstellst, nur tue es!“
– „Was tun?“
– „Du weißt schon, was zu tun ist“, sagte sie und legte die Hand eine Sekunde lang auf meinen Nacken. Ich beugte den Kopf und konzentrierte mich darauf, die Berührung ihrer Handfläche zu spüren. Vergeblich.
Sarah drehte sich um und ging langsam zur Tür. Ich betrachtete ihre Gestalt und fragte mich, ob dieser Anblick in mir etwas regte, dessen Vorahnung ich an jenem Morgen schon beim Aufwachen verspürt hatte, oder ob ich erst jetzt und allein durch ihn begonnen habe, mir diese Vorahnung einzubilden. Auf der Türschwelle wendete sie sich zu mir und lächelte mich an. Diesmal glaubte ich, eine etwas hämische, ja, beinahe sarkastische Spiellust in ihrem Blick zu deuten.
– „Wir sehen uns!“ sagte sie und verschwand.
Ich atmete aus.
Die Begegnung mit Sarah Sylvia Sander war der Auftakt zu einer Reihe von Ereignissen, die mich während der nächsten fünf Jahre in ein Gewirr von verrückten Umständen verstricken sollte. Als wären kleine, in sich einheitlich und durchaus logisch erfassbare Geschehensbrocken von einem Zufallsgenerator neu aufgemischt und in meinen Alltag hineingeschleust worden. Wenn ich das Adjektiv verrückt wähle, tue ich es bewusst in seinem ursprünglichen Sinn: ver-rückt: von der Stelle, die uns greifbar, zugänglich ist, also „normal“ ist, weg gerückt.
Ein Prickeln, das erregte Unbehaglichkeit hervorrief, war das durchgehende Gefühl,das mich währenddessen beschlich. Das Abweichen vom Normalen war nicht spektakulär genug, um die Ereignisse ins Phantastische rücken zu lassen, sie sich an einer mir erkennbaren Stelle wieder finden zu lassen, wie zum Beispiel an der der reinen Fiktion. Dies hätte mir erlaubt, die „Ver-rücktheit“ zu akzeptieren. Sie geschahen nur ganz wenig abseits der „normalen“ Stelle, als sähe man alles doppelt, wobei die Dopplung selbst vom Original auf fast unmerkliche Weise abwich und es somit relativierte.
Dazu kam auch der Alltag an sich, der reichlich Verwirrung stiftete. Die wiederholten Unterbrechungen durch die anderen Geschichten meines Lebens sorgten immer wieder dafür, dass ich den roten Faden verlor. Zuweilen ließ ich mich von abenteuerlich entgleisenden Unterfangen verleiten und geradezu verführen.
Die Ereignisse um Sarah holten mich aber jedes Mal unweigerlich ein, brachten mich zu sich zurück. Es blieb mir nichts sonst übrig, als dass ich ihren Umwegen folgte, um zu sehen, wohin sie mich letztendlich führen würden.[1]
Manchmal war ich kaum noch imstande, an etwas anderes zu denken als daran, wie ich den Knoten, der die Pfade meines Lebens mit denen so vieler anderer, die Sarah in mein Leben eindringen ließ, fest verschlungen hielt, hätte schneller entwirren können. Nach einer Weile konnte ich mein Leben von deren Leben, meine Wünsche und Träume von den ihrigen, meinen Willen von ihrem kaum noch unterscheiden. Unter solchen Umständen schien mir das Niederschreiben dessen, was dieser Prozess in meiner unmittelbaren Realität vollbrachte, die einzig vernünftige Taktik, um zu dem Kern des Knotens zu gelangen und ihn zu lösen. Um mich zu befreien.
Ich nahm mir vor, eine Chronik anzulegen, die alle Fakten aufzeichnet, ohne sie zu interpretieren.
Sarahs Besuch in meinem Arbeitszimmer ereignete sich an einem verhängnisvollen Sonntag, an dem die meisten Beteiligten an dieser Geschichte mit dem Tod konfrontiert wurden oder an ihn denken mussten.
* * *
Eine Vorschau auf: Abhauen, Roman von Ioona Rauschan, 336 Seiten, Pop Verlag, Ludwigsburg 2008.
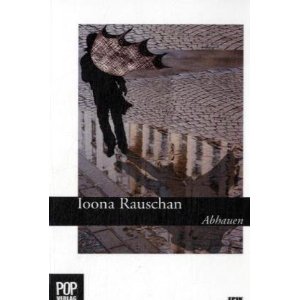
Auf der Schwelle. Ein Filmessay über Heinrich Heine von Ioona Rauschan. Edition Biograph, 1997
Die schöne Strickerin, Novelle von Ioona Rauschan, Edition Biograph, Düsseldorf 1995. (Antiquarisch erhältlich).
Weiterführend →
Ein Kollegengespräch mit Ioona Rauschan findet sich hier. Das Live-Hörspiel 5 oder die Elemente wurde in der Regie von Ioona Rauschan mit Marion Haberstroh und Kai Mönnich im Gutenberg-Museum zu Mainz uraufgeführt. Señora Nada, in der Regie von Ioona Rauschan, ist auf Hörbuch Gedichte erhältlich. Probehören kann man das Monodram Señora Nada in der Reihe MetaPhon.
[1] Rückblickend denke ich, dass es eine gute Entscheidung war, mich auf das Unberechenbare einzulassen. Obwohl man nie richtig wissen kann, wie es hätte anders kommen können, hätte man an dieser oder jener Wegkreuzung eine andere Richtung eingeschlagen. Ich habe oft, an irgendeiner Wegkreuzung angelangt, inne gehalten, um die bevorstehenden Wahrscheinlichkeiten zu erwägen, wohl wissend, dass dies zwecklos war, da man unmöglich alle Wahrscheinlich-keiten vorauszuahnen vermag. Am Ende erwies sich, dass ich recht hatte – den Weg, den ich hinter mir ließ, hätte ich am Anfang nie für wahrscheinlich gehalten.